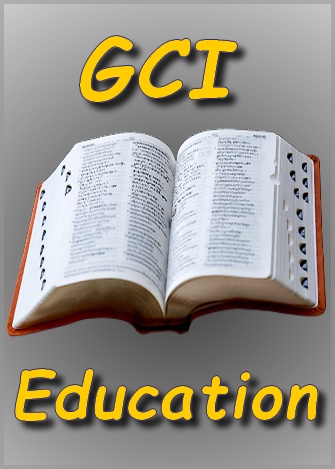
2. Gott
„Gott lieben? Manchmal hasse ich ihn.“[1] Diese Worte brachte einer der berühmtesten Christen der Welt – der deutsche Reformator Martin Luther (1482-1546) – hervor. Muten sie nicht merkwürdig an, solche Worte aus dem Mund eines Menschen, der sein Leben in den Dienst Gottes gestellt hatte?
Die Begegnung mit Gott stellt man sich häufig vor als angenehme, sterile Erfahrung, die sich fein säuberlich in Postkartenformat oder undeutlichen, unbestimmten Akzeptanzgefühlen erfassen lässt. Doch die Verfasser der Texte, die in der Heiligen Schrift über Allgegenwart und Wesen Gottes berichten, konfrontieren uns immer wieder mit einem weitaus weniger angenehmen oder auch nur verständlichen Bild.
„Gott ist ein verzehrendes Feuer“, schrieb der eine.[2] Das Volk Israel zeigte sich erschreckt angesichts der Gegenwart Gottes: „Lass Gott nicht mit uns reden, wir könnten sonst sterben“, sprachen sie zu Mose, der sie durch die Wüste führte.[3]
Und doch umschreibt sich dieser Gott mit dem Wort „Liebe“: „Gott ist die Liebe“, sagt die Bibel.
Was hat all das zu bedeuten? Was oder wer ist „Gott“? Ist der Glaube an Gott gerechtfertigt? Stimmen alle Glaubensrichtungen im Wesentlichen überein? Und wenn der Glaube an Gott grundlegend für das christliche Bekenntnis ist – ist diese Grundlage gesichert?
Bevor wir uns mit solchen Fragen auseinandersetzen, sollten Sie sich einen Augenblick Zeit nehmen und überlegen, welches „Bild“ Sie von Gott haben. Welche Vorstellung haben Sie? Welche emotionale oder mentale Reaktion löst sie in Ihnen aus? Glauben Sie an Gott? Oder glauben Sie nicht an ihn? Oder sind Sie sich unsicher? Warum?
In unserer heutigen westlichen Gesellschaft wird erheblicher Aufwand getrieben, um Alternativen zum Gott des Christentums, des Judentums und des Islams als drei der fünf großen Weltreligionen vorzustellen. Gerade die Energie aber, die nun darauf verwendet wird, die Allgegenwart Gottes zu leugnen und alternative Erklärungen für unser Universum herbeizuschaffen, erinnert uns daran, dass der Glaube an Gott für die meisten Menschen in unserer Welt seit jeher als Anschauung und Verständnishilfe von grundlegender Bedeutung gewesen ist. „Atheismus und Agnostizismus sind, statistisch gesehen, weltweit vernachlässigbare und gewöhnlich in weltläufigen und wohlhabenden urbanen Kreisen anzutreffende Lehrmeinungen, die in der ganzen Menschheitsgeschichte keine uns bekannte Kultur haben prägen können“, sagt der britische Autor und Lehrer Michael Green.[4]
Die Juden glauben an Gott (Jahwe) aufgrund einer historischen Berichterstattung über archäologische, literarische, religiöse, soziale und kulturelle Zusammenhänge, aus der die unmittel-
bare Interaktion Gottes mit den eigenen Vorfahren ersichtlich wird. Sie glauben, dass Gott die Welt erschaffen, seine Gegenwart und seinen Willen gegenüber Stammvätern und Propheten bekundet und sich durch die Übergabe des Gesetzes an Mose am Berg Sinai offenbart hat. Seine Gegenwart und sein Wille werden dem Volk Israel durch die Thora (die ersten fünf Bücher des Alten Testaments) kundgetan.
Muslime glauben an Gott (Allah) aufgrund der Lehren des Propheten Mohammed, der Polytheismus (Vielgötterei) und Aberglauben zurückwies und den einen wahren Gott verkündete. Mohammed zeichnete die Visionen, Botschaften und Offenbarungen auf, die er nach eigener Aussage von Gott empfangen hatte. Im Islam glauben die Menschen an Gott als den höchsten, allmächtigen, souveränen Herrscher und Richter, der so anders als seine Schöpfung ist, dass er von ihr weder erkannt noch beeinflusst werden kann.
- Gott hat sich unserer Welt offenbart, indem er Mensch geworden ist in der historischen Person Jesu von Nazareth.
- Gott wirkt in denen, die ihm Ehre erweisen, durch den Heiligen Geist, der ihnen geistige Führung und seelischen Trost gewährt.
- Sein Eingreifen in die Menschheitsgeschichte ist in der christlichen Bibel aufgezeichnet.
- Seine Allgegenwart zeigt sich in der Schöpfung der Welt um uns herum.
- Seine Kommunikation mit der Menschheit durch Jesus Christus und die Bibel in ihrer Gesamtheit offenbart göttlichen Willen, Zweck, Bedeutung und Plan für die menschliche Existenz.
- Sein Wort steht gegen Sünde, Leid und Tod in der Person Jesu Christi und für das Versprechen der Vergebung und Versöhnung mit ihm.
Diese Glaubensgrundlagen sind nicht leicht zugänglich. Es ist nicht so, dass Gott immer „Sinn macht“; und ganz sicher ist er auch nicht der Geist in der Flasche, der uns zu Diensten wäre.
An Gott glauben heißt, dass wir unser Leben seinem Willen und seiner Führung anvertrauen. Und das kann schwer sein – wie es Martin Luther so kraftvoll zum Ausdruck gebracht hat. Gott weiß darum. „Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken“, schreibt der Prophet Jesaja in Kapitel 55, Verse 8 und 9.
An Gott glauben – das ist kein Spaziergang durch den Park. Es ist eine Herausforderung. Wir haben es mit etwas – mit Einem– uns in seiner Andersartigkeit völlig Unbekanntem zu tun.
Ein besonders häufig anzutreffendes Missverständnis in Sachen religiöser Glaube ist die Annahme, „alle Religionen glauben dasselbe“ oder „wir glauben alle an Gott“. Wir werden gleich darauf eingehen, wollen zuvor aber noch erörtern, warum manche Menschen nicht an Gott glauben (Atheisten) oder nicht wissen, ob sie an Gott glauben können (Agnostiker).
Im Folgenden sind Argumente, Fragen oder Meinungen zusammengestellt, wie sie häufig als Grund für die Nichtexistenz Gottes angeführt werden: „Der Glaube an Gott mag als emotionale Krücke lächerlich gemacht werden, aber vielleicht sollten wir davon ausgehen, dass gerade der Nichtglaube an Gott (Atheismus) die eigentliche emotionale Krücke ist – für diejenigen nämlich, denen der Glaube zu schwer oder unbequem erscheint.“
Es gibt viele Dinge im Leben, die sich nicht „beweisen“ lassen. Können Sie beweisen, dass Ihre Mutter Sie liebt? Können Sie beweisen, dass die Sonne am nächsten Morgen wieder aufgeht? Können Sie beweisen, dass es keinen Gott gibt?
Unsere moderne Welt mag auf ihren rationalen und materialistischen Ansatz stolz sein – dennoch hat es im Leben immer eine geistige Dimension gegeben, die jedes menschliche Wesen real und bewusst erfährt. Es gibt Realitäten in unserem Leben, die wichtige Fragestellungen und einen über unsere physische Welt hinausgehenden Erklärungsbedarf erkennen lassen.
Wir werden uns diesen Fragen gleich zuwenden. Doch wie können wir derartige Realitäten mit unserem Verstand und unserer Vernunft erklären? Der Versuch, die Nichtexistenz Gottes beweisen zu wollen, dürfte noch schwerer fallen als der Versuch einer Beweisführung, dass es einen Gott gibt.
Umgekehrt kann natürlich auch der Nichtglaube an Gott eine emotionale Krücke sein, die solchen Menschen gelegen kommt, denen der Glaube an Gott zu schwer oder unbequem erscheint.
Der Glaube an Gott ist eine reale emotionale Stütze, bedeutet zugleich aber eine intensive Herausforderung für den Menschen. Wer glaubt, dessen Glaube stützt sich nicht auf einer emotionalen Krücke ab, sondern gründet in einer Kombination aus intellektuellen und geistigen Überzeugungen, Erfahrungen und Gefühlen.
Dazu drei Antworten:
- Die Tatsache, dass es Böses und Leid gibt, bedeutet noch lange nicht, dass es keinen Gott geben kann – es könnte zumindest ein grausamer, gefühlloser Gott sein.
- Wenn es auch Gutes in der Welt gibt – wessen Verdienst ist es dann? Ist es Gottes Verdienst oder das Verdienst der Menschheit? Und wenn es das Verdienst der Menschheit ist – warum rechnen wir uns dann nicht auch das Böse an?
- Es gibt Böses und Leid in unserer Welt – es stellt sich die Frage nach dem Warum. Es ist aber weder sinnvoll noch logisch, in Anbetracht übler Zustände den Schluss zu ziehen, es könne keinen Gott geben.
Sicher, es gibt Naturwissenschaftler, die den Glauben an das Göttliche zurückweisen, aber andererseits gibt es auch viele, viele Naturwissenschaftler, die einen starken Glauben an Gott – einen Schöpfergott – bekunden. Die herkömmliche Vorstellung, Wissenschaft sei mit Religion von vornherein unvereinbar, ist schlicht irreführend. Selbst die Ursprünge moderner wissenschaftlicher Entdeckungen sind eng mit dem christlichen Glauben verbunden.
„Die Revolution in den Naturwissenschaften wurde nicht im Zuge einer Bewegung zum Atheismus eingeleitet, sondern während einer Glaubensreformation“, schreibt Fred Heeren, Wissenschaftsautor und Herausgeber von Cosmic Pursuits.[5]
Johannes Kepler, Astronom aus dem 17. Jahrhundert, war zu der Erkenntnis gelangt, dass die Erde um die Sonne kreist – und bezüglich seiner Entdeckungen äußerte er sich dahingehend, er denke lediglich die Gedanken Gottes nach.
„Religion ohne Wissenschaft ist blind“, hat der Physiker Albert Einstein einmal gesagt, und „Wissenschaft ohne Religion ist lahm“.[6]
Vielleicht hat insbesondere die Evolutionstheorie aus dem 19. Jahrhundert zu der Auffassung beigetragen, die Welt brauche keinen Gott. Wir wollen uns dieser Theorie kurz zuwenden.
„Im Wesentlichen ist mit der ‚Evolution‘ der Anspruch verbunden, die Wissenschaft habe einen Mechanismus aufgezeigt, nach dem sich extrem komplexe biologische Organismen gestalten und entwickeln lassen, ohne der Hilfe eines Schöpfers zu bedürfen“, schreibt Philip E. Johnson, Autor der beiden Bücher Testing Darwinism und Reason in the Balance.[7] Dies ist die Behauptung, die den Darwinismus mit dem Atheismus verbindet – nur ist sie falsch.
Tatsache ist, dass der darwinsche Mechanismus der Mutation und Selektion niemals nachweislich mehr zustande gebracht hat als triviale Variationen in grundlegend stabilen Populationen. Eine Evolution findet statt, wenn man so will, aber sie bewirkt nichts Wesentliches und vermag in keiner Weise zu erklären, wie Leben beginnt oder wie Leben so kompliziert werden konnte. Die kreative Kraft der natürlichen Selektion ist nie nachgewiesen worden; die wirklich wissenschaftlichen Beweise sprechen vielmehr gegen die Behauptung des Darwinismus, zufällige Mutationen bewirkten komplexe Organe und Organismen über den Prozess der natürlichen Auslese.“[8]
Die Mikroevolution (eine Veränderung durch Genmutation und natürliche oder beabsichtigte Selektion in einer Spezies) ist ein Faktum des Lebens – wie beispielsweise an der Züchtung von Hunden und Tulpen unschwer zu erkennen ist. Aber große Hunde und kleine Hunde sind nach wie vor Hunde. Charles Darwin behauptete nun, diese mikroevolutionäre Veränderung könnte schließlich die Artengrenze überschreiten und damit eine Makroevolution auslösen. Allerdings musste sich selbst Darwin fragen, warum es keine fossilen Beweise für irgendwelche Lebensformen im Übergang gab. Er räumte ein, das Fehlen solcher Beweise sei „der größte Einwand, der gegen meine These vorgebracht werden kann“. Und solche Beweise gibt es einfach nicht.
„Die Darwinisten gehen von einer philosophischen Position aus, die als Materialismus bezeichnet wird“, sagt Johnson. „Sie behaupten, am Anfang hätte es nur Partikel und unpersönliche Naturgesetze gegeben, nichts anderes. Wenn das zutrifft, dann muss logischerweise auch etwas zutreffen, was dem Darwinismus sehr nahekommt, ungeachtet jeder Beweislage. Da Darwinisten von vornherein davon ausgehen, dass ihre Theorie zutrifft, finden sie auch überall Beweise.“
Der Mikrobiologe Michael Behe hat in seinem Buch Darwin’s Black Box die Beweissituation für die Evolution auf mikrobiologischer Ebene untersucht. Die Mikrobiologie ist ein Bereich, den Darwin nicht untersucht haben konnte, weil zu seiner Zeit die Instrumente und Techniken einfach noch nicht ausreichten. Doch wenn die Evolution maßgeblich für das Zustandekommen von Leben ist, dann müsste sich dies an den Kleinstformen des Lebens ebenso zeigen wie an Dinosauriern.
Wir wissen heute, dass Mikroorganismen nicht nur ein Klümpchen Materie sind. Vielmehr weisen sie eine komplexe und hochgradig strukturierte Anatomie auf. Wie Behe entdeckte, gelangt man auf mikrobiologischer Ebene an einen Punkt, den er als „irreduzible Komplexität“ bezeichnet: Alle Teile eines Organismus stehen in Wechselbeziehung zueinander.
Behe zieht zum Vergleich einen einfachen Allerweltsgegenstand heran – die Mausefalle. Diese allem Anschein nach simple Vorrichtung ist irreduzibel (nicht wiederherstellbar) komplex: Wenn man auch nur ein Teil entfernt, funktioniert das Ganze nicht mehr. Eine Mausefalle hätte nicht per Evolution entstehen können. Sie musste gestaltet werden.
Keiner käme auf die Idee, in Anbetracht einer großartigen technischen Konstruktion, beispielsweise einer Brücke, eines Gebäudes oder eines Autobahnsystems, auszurufen: „Wie schön, das ist ganz von selbst entstanden!“ Ebenso wenig würde jemand, der einen Wandteppich betrachtet, einer Oper lauscht oder ein literarisches Werk liest, die Meinung vertreten, all dies habe seine komplizierte Struktur und Schönheit aus sich heraus entwickelt. Wie kann es denn Sinn machen, dass wir uns solche geplanten, intelligenten, kreativen Bemühungen zuschreiben und dennoch eine höhere Form geplanten, intelligenten, kreativen Vorgehens in der natürlichen Welt höhnisch in Abrede stellen? Wenn wir all die Beweise für intelligente Gestaltung, Ordnung und Zweckbestimmung um uns herum sehen – können wir dann wirklich noch glauben, dass die Welt, in der wir leben, zufällig entstanden ist? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit?
Sie ist in etwa der Annahme vergleichbar, eine Explosion auf einem Schrottplatz könnte einen Rolls Royce produzieren. Selbst wenn es vorstellbar wäre, dass eine physische Welt durch Zufall entsteht – wie wären darüber hinaus unsere menschlichen Fähigkeiten in Bezug auf Denken, Begründen, Argumentieren, logisches Schlussfolgern und Fühlen wie auch die einmaligen individuellen Persönlichkeiten und Temperamente zu erklären? Und wie steht es mit „Gut“ und „Böse“? Moral? Gewissen?
Und dann die Religion. Warum strebt der Mensch über alle Zeiten und Kulturen hinweg nach einem Verständnis der eigenen Existenz in einem größeren, geistigen Kontext? Wohin man sich auch wendet – allem Anschein nach hat es zu jeder Zeit und in jeder Kultur unterschiedliche Formen religiöser Verehrung gegeben. Die Überreste von Tempeln, Altären und religiösen Riten stammen aus frühesten Zeiten. Selbst unter jahrzehntelanger atheistischer Herrschaft ist Glaube bekundet worden.
Auch wenn das Wort „Religion“ aus dem Sprachgebrauch verbannt wird – in jeder Kultur gibt es zwingende Beweise für die Anerkennung von Prinzipien wie „Richtig und Falsch“, „Gut und Böse“, „Ehrlichkeit und Betrug“. „Gewissen“ ist eine Realität menschlicher Erfahrung und Interaktion. Warum sollte es so etwas wie ein Gewissen geben, wenn wir lediglich Zufall der Natur wären; wenn wir „einfach da und dann nicht mehr da“ wären? Manche meinen, das Gewissen sei lediglich ein Mittel sozialer Zweckmäßigkeit, aber selbst dabei wird übersehen, dass das Gewissen Menschen häufig veranlasst, entgegen der herrschenden sozialen Normen oder Gruppenzwänge zu handeln. Und als Eigeninteresse lässt sich Gewissen auch nicht abtun, denn wie häufig führt gerade das Gewissen zu Selbstverleugnung und Aufopferung.
Meinungsumfragen und nationale Statistiken weisen aus, dass in großen Teilen der westlichen Welt zwischen 70 und 90 Prozent der Bevölkerung an Gott glauben. Dabei beschränkt sich der Gottesglaube nicht auf die „christliche“ Welt; einige nichtchristliche Glaubensrichtungen bezeugen starken Glauben an Gott, während andere dies nicht tun und vielmehr von „Bedeutung“, „Prinzip“ oder „Zweck“ in unserem Universum sprechen und damit eindeutig auf etwas Geistiges und Reales verweisen. Also sind sich die meisten Menschen der Gegenwärtigkeit – oder zumindest der Existenzmöglichkeit – von Gott oder etwas Gottähnlichem irgendwie bewusst.
Der Theologe John Calvin hat dieses menschliche „Bewusstsein“ von der Existenz Gottes als den „Samen der Religion im Herzen eines jeden Menschen“ bezeichnet. Und doch tragen die „Samenkörner“ vielfältige Frucht. Was der eine unter „Gott“ versteht, kann für den anderen etwas ganz anderes bedeuten. Macht das einen Unterschied? Es macht einen Unterschied, weil nicht alle Religionen an Gott glauben. Und selbst in solchen Religionen, die an Gott glauben, gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen in Bezug auf die Kernbereiche des Lebens, des Sterbens und der Beziehung zu Gott.
Christentum, Judentum und Islam sind die monotheistischen Weltreligionen (in denen es den „einen Gott“ gibt). In allen dreien wird Gott als der Schöpfer von Lebewesen verstanden, die sich von ihm unterscheiden und ihre eigene Entscheidungsfreiheit und Realität haben. Während das Christentum mit Geburt, Lehre, Tod und Auferstehung von Jesus Christus vor rund 2000 Jahren begann, geht das Judentum noch 2000 Jahre weiter zurück – bis zu den Verheißungen, die Gott zunächst dem Stammvater Abram (später Abraham) und in der Folgezeit dem Volk Israel über dessen Anführer Mose gemacht hatte. Die Grundlagen des Islams sind zurückzuverfolgen zu den vom Propheten Mohammed (ca. 570-632 n. Chr.) empfangenen Offenbarungen, wie sie in der islamischen „Bibel“, dem Koran (Qur‘an), aufgezeichnet worden sind.
Während diese drei Religionen monotheistisch sind, gelten östliche Religionslehren wie Hinduismus, Buddhismus und Taoismus als monistisch – sie vertreten die Auffassung, dass „alles von grundsätzlich derselben Art ist“[9]. Die Anhänger dieser Lehren führen jede Erscheinung auf ein einziges einheitliches und universelles „Prinzip“, auf eine ultimative Realität, zurück: Brahman bei den Hindus, Dharma oder Sunya bei den Buddhisten, Tao („der Weg“) bei den Taoisten. Dieses einheitliche Prinzip, die ultimative Realität, ist weder persönlich noch beziehungsstiftend zu verstehen. Es ist einfach nur da. Monisten glauben (vereinfacht gesagt), es sei unser menschliches Los, die zur jeweiligen Wahrheit, zum Weg oder zum Prinzip führenden vorgeschriebenen Pfade zu erkennen und zu verfolgen beziehungsweise im Einklang damit zu leben. Ein Großteil der New-Age-Lehre ist der östlichen Religionsphilosophie verbunden, mit mehr oder minder fest eingebundenen Elementen des christlichen Prinzips.
Die Religionen der Welt lassen somit tiefgreifende Unterschiede in ihrem Gottesverständnis erkennen. Wie können wir das Wahre erkennen? Oder sind wir unserer Kultur, unserer Familie, unseren Verstandeskräften verhaftet? Dazu wollen wir uns die folgenden Argumente ansehen.
Der größte Teil der Menschheit hat seit jeher die beste Erklärung für die eigene Existenz und für ihre Welt im Glauben an Gott gefunden. Es gibt gute Gründe für diesen fast universellen Gottesglauben. Einige sollen nachstehend genannt werden. Es sind keine Theorien. Es sind Fakten, die einer sowohl individuellen als auch kollektiven Abwägung wert sind:
- Die Welt, in der wir leben
- Gestaltung der Welt
- Menschliche Vernunft und Kreativität
- Persönlichkeit
- Werte
- Gewissen
- Religion
Jedes einzelne Faktum macht mehr Sinn, wenn Gott existiert. Insgesamt betrachtet wird die Existenz Gottes umso überzeugender. (Auszüge aus My God von Michael Green, Eagle, 1991.)[10] Alle hier hervorgehobenen Argumente sind reale Elemente der menschlichen Existenz. Wie gehen wir mit diesen Fakten um? Wie erklären wir sie? Die Feststellung, sie „seien eben da“, reicht nicht – wir müssen fragen, warum sie da sind und welche Konsequenzen sich aus ihnen für den Glauben an Gott ergeben. Gewöhnlich werden drei mögliche Aspekte genannt, unter denen die Allgegenwart Gottes in unserer Welt zu erkennen ist:
Die „generelle Offenbarung“ der Welt um uns herum – die Beweise für Gestaltung, Ordnung und Zweck; die Offenbarung der Bibel, die als Wort Gottes gilt; und die „spezielle Offenbarung“ als das persönliche Eingreifen Gottes in das Leben des einzelnen Menschen, dem er auf diese Weise seine Gegenwart zu erkennen gibt.
Im vorliegenden Abschnitt haben wir uns hauptsächlich auf die „generelle Offenbarung“ konzentriert. In unserer nächsten Folge wollen wir uns der christlichen Bibel, der Heiligen Schrift, zuwenden.
Was macht mehr Sinn – dass Zufall, Zeit und eine in jüngerer Zeit aufgestellte, unbewiesene Theorie zur Entwicklung unserer natürlichen Welt diese Realitäten „irgendwie“ zusammengefügt oder „geschaffen“ hat? Oder dass die Welt, die wir um uns (und in uns) sehen, einen Schöpfergott nahelegt, der einen Zweck und Plan für seine Schöpfung verfolgt? Wenn es einen Gott gibt, sind wir gut beraten, mehr über ihn und seine möglichen Pläne mit uns zu erfahren. In den weiteren Folgen werden wir uns ausführlicher damit auseinandersetzen.
Meinen Sie, dass den meisten Menschen der Glaube an Gott eher leicht oder schwer fällt?
Warum? Wie ist es bei Ihnen persönlich?
Was sind für Sie die wichtigsten Fakten, Realitäten oder Beweise für die Allgegenwart Gottes?
Was sind für Sie die wichtigsten Fakten, Realitäten oder Beweise gegen die Allgegenwart Gottes?
Halten Sie die Auffassung für vernünftig und logisch, jenseits der unmittelbaren materiellen, rationalen Erfahrung gäbe es nichts – nicht einmal die Möglichkeit einer außerhalb unseres Bewusstseins vorhandenen Wirklichkeit?
Zu Anfang haben Sie überlegt, welches „Bild“ Sie von Gott haben und ob Sie an ihn glauben (oder nicht glauben). Inwieweit hat die Lektüre unserer Ausführungen Ihre Gedanken beeinflusst?
Stellen Sie sich einen Augenblick lang vor, Sie seien sich der realen Gegenwart eines allmächtigen Gottes bewusst, der sich seiner Welt – und Ihnen persönlich – zu erkennen gegeben hat. Welche Reaktion würden Sie für angemessen halten, und wie würden Sie auf dieses Bewusstsein reagieren?
Wir möchten Ihnen empfehlen, eine dem modernen Sprachgebrauch angepasste Bibel zu wählen (zum Beispiel Hoffnung für alle 2015, Schlachter 2000, Luther 2017) und die folgenden Passagen zu lesen: aus dem ersten Buch Mose die Kapitel 1-3; aus dem Psalter die Psalmen 8 und 19; aus der Apostelgeschichte des Lukas Kapitel 17, Verse 16-34.
Atheismus – die Anschauung, dass es keinen Gott gibt.
Agnostizismus – die Lehre, dass wir nicht erkennen können, ob Gott existiert oder nicht (Unsicherheit über die Existenz Gottes).
Rationalismus – die Überzeugung, dass rationales Denken zur Erkenntnis von Wirklichkeit und Wahrheit führt (ohne Hinzuziehung von Erfahrung oder Intuition).
Materialismus – Anschauung, die alles Wirkliche nur auf die Materie zurückführt.
Darwinismus – die Theorie vom evolutionären Ursprung der Tier- und Pflanzenarten über den Prozess der natürlichen Auslese.
Gottheit – ein Gott oder eine Göttin.
Monismus – philosophische Lehre, die jede Erscheinung auf ein einheitliches Prinzip zurückführt.
Monotheismus – der Glaube an einen einzigen höchsten Gott.
Polytheismus – der Glaube an viele Götter.
Die Kapitel 1 bis 3 im ersten Buch Mose berichten, wie Gott die Welt erschaffen hat.
Die Psalmen 8 und 19 sind Loblieder, in denen die Herrlichkeit der Schöpfung Gottes besungen wird.
Die Apostelgeschichte 17,16-34 berichtet von der Auseinandersetzung des Apostels Paulus mit den Philosophen aus Athen.
„[Gott hat all dies für die Menschen getan,] damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten; und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns“ (Apg 17,27). ❏
Dieses Bibelstudium erschien zuerst unter dem Titel Foundations of Faith als Beilage von Living Today, der australischen Zeitschrift der GCI.
[2] Hebräer 12,29.
[3] 2. Mose 20,19.
[4] Green, Michael: Evangelism Through the Local Church (Evangelisation durch die lokale Gemeinde), S. 143 (Hodder & Stoughton, 1993).
[5] Heeren, Fred: Show Me God: What the message from space is telling us (Zeig mir Gott: Was für eine Botschaft gibt uns der Weltraum), Day Star Network, 1997.
[6] Davies, Paul: God & the New Physics (Gott und die neuen Physiker), S. 47 (Simon & Schuster, 1983).
[7] Intervarsity Press.
[8] Zitat aus einem Interview, das in The Plain Truth (UK), Juni-Juli 1998, veröffentlicht wurde.
[9] Guide to Human Thought (Ein Führer zum humanen Denken), hrsg. Von Kenneth McLeish (Bloomsbury Publishing, 1993).
[10] Green, Michael: My God (Mein Gott), S. 8 (Eagle, 1991).
© Stiftung WKG in Deutschland

