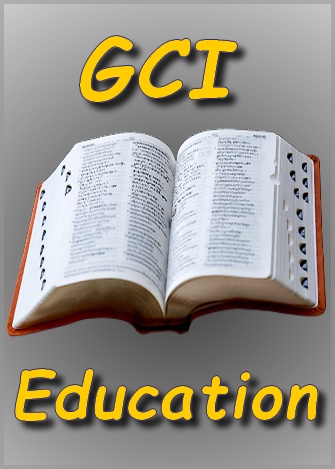
4. Die Botschaft der Bibel – Gottes Wort für uns?
„Am Anfang schuf Gott ...“ So fängt die Bibel an. Sie endet mit: „Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen!“ Mit diesen ersten vier Wörtern und dem letzten Satz erhalten wir einen Rahmen für die Lektüre und das Verständnis des gesamten Buches.
Im Wesentlichen macht uns die Bibel mit EINEM bekannt. Mit einem, von dem wir erfahren können, wer wir sind, warum wir so und nicht anders sind, wohin wir gehen und wie wir dorthin gelangen. Mit einem, der persönliche Anteilnahme bekundet. Mit einem, der gewillt ist, sich uns zu offenbaren.
Die Bibel erzählt SEINE Geschichte. Die Worte in diesem Buch handeln von Gott. Es sind Worte über Gott, die für uns bestimmt sind. Warum? Weil uns die Bibel mit der Geschichte über Gott auch etwas über unsere Welt und die Beschaffenheit der Menschen berichtet, über uns selbst und unsere Beziehungen untereinander, über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Vor allem aber sagt uns die Bibel, dass Gott uns liebt und dass er in der Person Jesu Christi persönlich auf unsere Existenz einwirkt, um eine Welt zu ordnen, in der offensichtlich so viel im Argen liegt. Doch die Bibel mahnt uns auch, dass jedem Einzelnen von uns eine Aufgabe in Gottes Wirken zuwächst – jeder Einzelne ist aufgerufen, seine Worte an uns und sein Angebot zu bedenken. Wir sind aufgefordert, seine Botschaft nicht nur zu lesen, sondern danach zu handeln.
Diese Botschaft ist aufregend und ernüchternd zugleich, befreit und fordert, belohnt und verlangt Rechenschaft ... „Die Bibel wurde uns gegeben, um von dem einen Gott, Schöpfer und Erhalter des Universums zu zeugen ... Sie erzählt eine Fortsetzungsgeschichte – die Geschichte von der Erlösung der Menschheit.“[1]
In der letzten Folge haben wir erkannt: Wenn wir die Botschaft der Bibel erörtern, geht es um die Botschaft Gottes an uns. Mit dieser Botschaft – wie auch mit der Schöpfung und der Menschwerdung Jesu Christi auf Erden – will Gott sich uns offenbaren. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, wenn wir die Bibel lesen.
Die Verfasser der biblischen Texte berufen sich übereinstimmend auf die Macht Gottes – auf seine Inspiration, Anleitung und Führung. Es soll an die 4000 Variationen des folgenden Satzes geben: „Das Wort des Herrn kam zu mir und sprach ...“[2] Teile der Bibel lesen sich unmittelbar wie Worte Gottes: „Ich, ich bin der Herr, und außer mir ist kein Heiland“ (Jesaja 43,11). „Ich bin der Erste, und ich bin der Letzte, und außer mir ist kein Gott“ (Jesaja 44,6).
Die Absicht Gottes, sich der Menschheit zu offenbaren, ist sowohl im Alten als auch im Neuen Testament von zentraler Bedeutung.
Im Alten Testament geschehen im Wesentlichen fünf Dinge:
Gott erschafft die Welt; Gott schließt einen „Bund“ (ein anderes Wort für „Testament“ im Sinne eines Abkommens oder eines Vertrages) mit einer Gruppe von Menschen, die er für seinen Zweck auserwählt hat; die Auserwählten (das Volk Israel) sind nicht fähig, den Anforderungen des Bundes gerecht zu werden; sie erleiden die Konsequenzen. Doch über eine Reihe von Propheten verheißt Gott einen „neuen Vertrag“ – diesmal nicht für eine bestimmte Gruppe von Auserwählten, sondern für alle Menschen. Im Neuen Testament begegnen wir dem neuen Abkommen „im Fleisch“; wir erfahren, wie dieser neue Bund in unserem Leben wirkt und lebt; und wir erahnen seine künftige Erfüllung.
Diese zugegebenermaßen stark vereinfachte Einführung in die Botschaft der Bibel weist auf eine wichtige Erkenntnis hin: Indem wir die Bibel lesen, können wir Gott erfahren. Darüber müssen wir erst einmal nachdenken. Aber das ist noch nicht alles! Gott erfahren bedeutet mehr als nur von Gott zu erfahren. Es ist Gottes Wille, nicht nur von sich zu sprechen – er will sich „mitteilen“ als ein realer, lebenswichtiger Teil unseres Lebens.
„Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, so dass sie keine Entschuldigung haben“ (Römer 1,20).
Gott will, dass wir ihn erfahren. Und es ist seine Absicht, das eigentlich Unmögliche – Gott zu erfahren – möglich zu machen. Die Botschaft der Bibel berichtet uns nicht nur über Gott, sondern sagt uns, es sei Gottes Wille, dass wir ihn persönlich erfahren. Im Rahmen dieses Prozesses lernen wir uns selbst besser kennen, und dazu gehört auch unsere Einstellung zu unserem Schöpfer und Erhalter. Wir sind erschaffen, um Gott zu erfahren. Das ist es, was in unserem Leben und in unserer Welt fehlt. Das ist es, was uns die Bibel sagen will.
Die Bibel stellt Gott übereinstimmend als einen sprechenden Gott dar. Ausnahmslos wird er geschildert als derjenige, der die Initiative ergreift, um sich einer Welt zu offenbaren, die sonst nicht fähig wäre, ihn persönlich zu erfahren.
„Über alle Zeiten hinweg haben christliche Theologen wie auch Laien in keiner Weise gezögert, über eine persönliche Beziehung zu Gott zu sprechen“, schreibt der Theologieprofessor Alister E. McGrath. „So hat die Christenheit Gott eine ganze Reihe von Attributen – zum Beispiel Liebe und Zweckbestimmung – zugeschrieben, die stark persönliche Züge tragen.“[3]
Im Schöpfungsbericht im 1. Buch Mose wird geschildert, wie Gott mit Adam und Eva spricht und ihren Bedürfnissen in persönlicher Anteilnahme gerecht wird. Als sie sich ihm verweigern, verweist er sie aus dem Paradies, in dem sie mit ihm gelebt hatten. Durch die Geschichte vom Garten Eden und den Symbolismus vom „Baum des Lebens“ und vom „Baum der Erkenntnis von Gut und Böse“ (1. Mose 2-3) erfahren wir, dass die Menschheit heute infolge der Sünde von Adam und Eva mit dem Tod lebt: „Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben“ (Römer 5,12). Später spricht Gott mit Noah und bedient sich seiner, um eine einzige Familie vor der göttlichen Strafe für all das Böse, das die Erde ergriffen hatte, zu erretten. Danach schließt er mit Noah einen Bund mit der Verheißung, niemals alles Leben auf Erden zu vernichten.
„ ... Niemand würde die Wahrheit über Gott erfahren oder in der Lage sein, eine persönliche Beziehung zu ihm aufzunehmen, wenn Gott nicht als erster gehandelt hätte, um sich zu offenbaren. Aber genau das hat Gott getan, und die sechsundsechzig Bücher der Bibel ... sind insgesamt Bericht, Deutung, Ausdruck und Verkörperung seiner Selbstoffenbarung. Gott und Göttlichkeit ist die verbindende Thematik der Bibel.“[4] Im 19. Jahrhundert v. Chr. spricht Gott zu einem 75-Jährigen, der in der Region des heutigen Irak lebt: „Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein“ (1. Mose 12,1-3). Während der folgenden 100 Jahre seines Lebens spielen Abram (dem Gott später den Namen Abraham zuweist) und seine Söhne Isaak und Ismael eine entscheidende Rolle in der weiteren dramatischen Geschichte, die den Hauptteil des Alten Testaments ausmacht. Es ist die Geschichte vom Volk Israel (der Name ist übernommen von Abrahams Enkel Jakob, dem Gott den Namen Israel gibt – was so viel bedeutet wie „der mit Gott kämpft“). Israel ist von Gott gezielt für seine Zwecke ausgewählt worden. Ein Mann namens Mose, zu dem Gott gesprochen hatte, sollte das elendig versklavte Volk aus seiner Gefangenschaft im mächtigen ägyptischen Reich herausführen (wahrscheinlich im 15. Jahrhundert v. Chr.). Nach der Errettung spricht Gott durch Mose zu den Menschen und schließt einen Bund – ein Abkommen – mit ihnen (2. Mose 19-24). Über ein System von Gesetzen, Opfern, Priesterämtern und Jahresfesten verleiht Gott seinem Volk eine einmalige Identität und offenbart damit eine ganz besondere Beziehung: In einer Welt weitaus mächtigerer und bedeutenderer Nationen sowie zahlreicher Götter und Heiligtümer sind die erretteten Sklaven zum Volk Gottes geworden, dem er sich als der einzig wahre und überall zu verehrende Gott zu erkennen gegeben hat: „Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft“ (5. Mose 6, 4). Diese unter der hebräischen Bezeichnung Shema („hören“) bekannte Textstelle hat bis auf den heutigen Tag einen zentralen Stellenwert im jüdischen Gottesdienst. Ihre Aussage ist auch für den christlichen Glauben von grundlegender Bedeutung.
Das zweite bis fünfte Buch Mose (Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium), das Buch Josua, das Buch der Richter, die beiden Bücher Samuel, die beiden Bücher der Könige und die beiden Bücher der Chronik schildern in ihrer Gesamtheit die wechselhafte Geschichte des Volkes Israel und des Stammes Juda über eine Zeitspanne von rund 1000 Jahren. Wir erfahren, wie die Menschen Gott erst gehorchen und sich dann von ihm abwenden. Sie versuchen, nach dem mit ihren Vorfahren geschlossenen Bund zu leben, aber es gelingt ihnen nicht. Sie errichten Gott einen wunderbaren Tempel. Das Volk erreicht seine Blütezeit unter König David und seinem Sohn Salomo. Doch dann zerfällt das Großreich – die zehn Stämme im Norden trennen sich vom Königreich Juda (der königlichen Linie) im Süden. Während dieser turbulenten Zeiten spricht Gott zum Volk Israel und Juda durch Propheten wie Elias, Elisa und Jesaja, um die Menschen vor den Konsequenzen ihres sündigen Verhaltens zu warnen.
Die Propheten hoben besonders hervor, welche sozialen, moralischen, geistigen und politischen Konsequenzen es haben würde, wenn die Menschen Gott nicht beachteten. Durch sie tat Gott einmal mehr seinen Willen kund, von den Menschen erkannt und verehrt zu werden. Doch selbst in seinen Warnungen und Strafen ließ er Hoffnung für die Zukunft, denn Propheten wie Jesaja sollten von einem kommenden Messias künden: Immanuel, „Gott mit uns“, lautet die Weissagung (Jesaja 7,14).
Israel und Juda hörten nicht auf die von Gott gesandten Propheten und erlitten eine schreckliche Strafe. Im 8. Jahrhundert v. Chr. trieben die mächtigen Assyrer die im Norden ansässigen zehn Stämme so weit auseinander, dass sie nicht mehr als Volk erkennbar waren. Gut hundert Jahre später geriet Juda in die Gefangenschaft von Nebukadnezar, dem Herrscher Babylons, der die Stadt Jerusalem zerstören und den geweihten heiligen Tempel abbrennen ließ.
Unmittelbar vor und während der 70-jährigen Gefangenschaft Judas rief der Prophet Jeremia und später auch Hesekiel die Menschen auf, zu Gott zurückzukehren. Trotz aller Verzweiflung in der Gefangenschaft und trotz des Unvermögens der Menschen bewahrten sich diese Propheten, wie schon Jesaja, ihren Optimismus, zumal Gott ihnen die Wiederherstellung der ursprünglichen Beziehung und damit Hoffnung für die Zukunft verkündete. Dasselbe trifft auch auf die „kleineren Propheten“ zu (so bezeichnet, weil ihre Botschaften kürzer sind als die Hesekiels, Jeremias und Jesajas).
Das Alte Testament endet damit, dass das Volk Gottes den göttlichen Bund oder „Vertrag“ nicht einhalten konnte. Nicht einmal die scheinbar eindeutigen Regeln, die Gott für eine gerechte Beziehung zwischen sich und den Menschen vorgegeben hatte, wurden befolgt. So ist es um die Menschheit bestellt: Wir sind der Gegenwart Gottes einfach nicht wert. „Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken“ (Jesaja 55,8-9). Die Botschaft des Alten Testaments lautet unmissverständlich: Wenn wir die Beziehung zu Gott, für die wir erschaffen wurden, erfahren sollen, so ist uns dies nicht aus eigenem Antrieb möglich. In diesem Kontext ist der Beginn des Neuen Testaments zu sehen.
In Jesus hat sich Gott der Menschheit auf noch nie dagewesene, unerwartete und unerhörte Weise offenbart.
Die Evangelisten Matthäus und Lukas berichten von der Geburt eines Kindes: Die Eltern kamen aus bescheidenen Verhältnissen, und Ort der Begebenheit war ein abseits gelegenes Städtchen namens Bethlehem. Das Land stand zur damaligen Zeit unter der Herrschaft einer fremden Besatzungsmacht. Doch dieses Kind, so berichten die Evangelisten, erfüllte nicht nur die Worte der Propheten über einen Messias (einen Retter oder Erlöser), sondern war kein Geringerer als Gott in Menschengestalt.
„Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht (Jesaja 7,14): ‚Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben’, das heißt übersetzt: Gott mit uns“ (Matthäus 1,22-23). Lukas berichtet von einem alten Mann in Jerusalem mit Namen Simeon, der das Kind Jesus auf die Arme nahm, Gott lobte und sprach: „... denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht, zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel“ (Lukas 2,25-31). Der Apostel Johannes beginnt seinen Bericht mit den folgenden Sätzen: „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott ... Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit“ (Johannes 1,1-2; 14).
Alle Evangelisten bezeichnen Jesus eindeutig als den unter uns wohnenden Gott, als Gott in Menschengestalt. Der Verfasser des Briefes an die Hebräer beginnt so: „Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn ...“ (Hebräer 1,1-2).
Was hatte nun Jesus – der Messias, der Sohn Gottes, Gott in Menschengestalt, das Wort – zu sagen? Welche Werke hat er vollbracht? Zu welchem Zweck ist er zu uns gekommen?
Matthäus betont, dass Jesus der im Alten Testament verheißene Messias ist. Markus berichtet von den Wundern, die Jesus getan hat, und stellt sein Wirken auf Erden als Sohn Gottes in den Vordergrund. Lukas schrieb für eine nichtjüdische Zuhörerschaft und nannte Jesus den „Erlöser für alle“[5] – den menschgewordenen Gott, der Zuneigung, Anteilnahme und Mitgefühl für uns Sünder zu erkennen gibt. Und der Apostel Johannes sagt unmissverständlich, er habe seinen Bericht geschrieben, „damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen“ (Johannes 20,31).
Alle Verfasser bekunden die göttliche Eingebung, dass sich Gott der Menschheit in Jesus offenbaren wollte – diesmal in der Gestalt eines Menschen, wie wir es sind. Gott ist zu uns gekommen, um unter uns zu leben, mit uns zu leiden und für uns zu sterben.
Warum sollte er für uns sterben? Jesus selbst gibt die Erklärung: „Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde“ (Johannes 3,16-17). Jesus hat sein Leben für uns hingegeben und damit den „neuen Bund“ (den „Vertrag“) besiegelt, der von den Propheten geweissagt worden war (siehe Jeremia 31,31-34). „Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird“, hatte Jesus beim letzten Abendmahl zu seinen Jüngern gesagt. Fortan sollten nicht mehr Rituale und Tieropfer die Rechtfertigung der Menschheit vor Gott für all ihre Sünden symbolisieren; in Jesus hat sich Gott der Sünde „ein für alle Mal“ angenommen: „Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben ein für alle Mal ...“ (Römer 6,10). Jesus ist gekommen, um uns aus unserer Sterblichkeit und Hoffnungslosigkeit zu erretten. Gott ist in Menschengestalt zu uns gekommen, um uns zu versöhnen zu dem Zweck, zu dem er uns geschaffen hat.
Doch die Evangelien und die später verfassten Briefe und Berichte von Zeitgenossen, die Jesu Leben und Tod selbst miterlebt hatten, wie auch die Schriften von Leuten wie Saul aus Tarsus, der die christlichen Gemeinden zunächst verfolgt und bekämpft hatte, enthalten noch eine Botschaft, die über die Kreuzigung Jesu hinausgeht: Jesus ist nach drei Tagen auferstanden.
„Aber am ersten Tag der Woche sehr früh kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden.
Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war: Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen“ (Lukas 24,1-7).
Die Auferstehung ist für die Christenheit von zentraler Bedeutung: „Wenn man den ganzen christlichen Glauben in einer einzigen Aussage zusammenfassen wollte, so müsste dies die Aussage sein, dass Gott den gekreuzigten Jesus von den Toten auferweckt hat“, schreibt Shirley C. Guthrie in Christian Doctrine. „Ohne den Glauben an einen auferstandenen und lebendigen Christus gäbe es kein Christentum. Es waren weder Jesu Morallehren und Vorbild noch sein edelmütiger Tod, der zur Gründung der christlichen Kirche und ihrer Ausbreitung führte; es war die Nachricht von seiner Auferstehung.“[6]
„Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch fest steht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr’s festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe; es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe: Dass Christus gestorben ist für unsre Sünden nach der Schrift; und dass er begraben worden ist; und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift ...“ (1. Korinther 15,1-4). Und an späterer Stelle des Kapitels schreibt Paulus: „Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden“ (Verse 20-22).
Jesu Auferstehung verheißt uns ein Leben jenseits unserer physischen Existenz: „Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft“ (1. Korinther 6,14).
In seiner Gegenwart sühnte er die Vergangenheit und bereitete die Zukunft. Unsere Vergangenheit und unsere Zukunft sind in seiner Gegenwart geborgen.
Dies ist die Botschaft, die von der frühchristlichen Kirche immer und immer wieder verkündet wurde. In Jesus Christus allein gründet die Hoffnung der Menschheit. Nicht in irgendwelchen Werken, die wir vollbracht haben oder vollbringen können, sondern allein in Gott. Es ist Gottes Wille gewesen, sich seiner Schöpfung zu offenbaren, und dazu hat er sich so weit erniedrigt, dass er den Opfertod am Kreuz starb, um so seine vollkommene und allumfassende Liebe zu uns und seinen Wunsch, uns zu versöhnen, zu beweisen.
„Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingebornen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe: nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsre Sünden“ (1. Johannes 4,9-10).
Diese Liebe wird als die „Gnade Gottes“ bezeichnet: „Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist“ (Römer 3,23-24).
Das ist die Botschaft der Bibel – auf den Punkt gebracht. Gottes Liebe zu uns ist so groß, dass er sich uns, die wir aufgrund unserer Sünde nur den Tod verdient haben, in seiner Güte, Barmherzigkeit und Gnade nicht nur offenbart, sondern uns die Möglichkeit geschenkt hat, mit ihm versöhnt zu werden und seine Liebe und Gegenwart für alle Ewigkeit zu erfahren – wahrhaftig zu leben.
„Am Anfang schuf Gott ...“ Das ist der Beginn einer großartigen Geschichte, die mit den ermutigenden Worten endet: „Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen.“
„Denn, alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen; aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit‘.“ - 1. Petrus 1,24-25.
Diese Folge hat zweifellos eine Reihe von Fragen aufgeworfen – „Ja, aber ...?“ und „Aber warum ...?“ oder „Wieso ...?“ oder „Ich verstehe nicht, warum ...?“ Nehmen Sie sich die Zeit, über solche Fragen nachzudenken, die Ihnen bei unseren Ausführungen in dieser Folge gekommen sind. Schreiben Sie sich Ihre Fragen auf, denn es ist gut möglich, dass Sie bei der Lektüre weiterer Folgen Antworten darauf finden.
- Was ist für Sie der schwierigste Aspekt in der Auseinandersetzung mit der biblischen Botschaft?
- Was ist für Sie der leichteste oder eingängigste Aspekt in der Auseinandersetzung mit der biblischen Botschaft?
- Wir haben bei unseren Ausführungen verschiedene kurze Bibelstellen erläutert. Sie sollten sich nun die Zeit nehmen und einige längere Textstellen lesen, um ein besseres Gefühl für die Botschaft der Bibel zu bekommen – die Offenbarung der teilnehmenden Liebe Gottes und seines Planes für die Menschheit.
- Lesen Sie, wie Gott sich den Patriarchen Mose und Israel offenbart: 1. Mose 12-17; 46-47; 2. Mose 1-4; 19-20; 1. Samuel 1-12; 15-17; 2. Samuel 1-2; 5-7.
- Lesen Sie, wie sich Gott durch die Propheten mitteilt: 1. Könige 17-19; Jesaja 1-6; 49-57; Jeremia 1; 25-33; 39.
- Lesen Sie, wie sich Gott durch Jesus mitteilt: Johannes 1,1-8; Johannes 3,1-21; Johannes 5,37-40; Johannes 6; Johannes 11,45-21; 25; Römer 5; Epheser 2,1-10; Philipper 2, 1-11; Kolosser 1,1-23; Hebräer.
- Lesen Sie, wie sich Gott durch die Frühkirche und die Apostel mitteilt: Apostelgeschichte des Lukas.
Wiederum empfehlen wir Ihnen, eine dem modernen Sprachgebrauch angepasste Bibel für Ihre Lektüre zu wählen (zum Beispiel Hoffnung für alle 2015, Schlachter 2000, Luther 2017).
Apostel – Mit Apostel, dem griechischen Wort für „Sendbote“, werden die zwölf Jünger Jesu (als Boten des Evangeliums) sowie Paulus und einige andere Kirchenführer aus der Frühzeit bezeichnet.
Assyrer – das mächtigste Großreich im Vorderen Orient im 10. bis 7. Jahrhundert v. Chr.
Herr – Einer, der Macht über andere hat. Im Alten Testament erscheint das Wort häufig in Großbuchstaben („HERR“) und bedeutet „Jahwe“, ein Name für Gott. Im Neuen Testament steht der Name oft für Jesus.
Auferstehung – Die ursprüngliche Bedeutung ist „sich erheben“ (aus dem Grab); im übertragenen Sinn bedeutet Auferstehung, nach dem Tod zu neuem Leben erweckt zu werden. Die Auferstehung Jesu erfolgte nach seiner Kreuzigung. Die Bibel lehrt die Auferstehung aller Toten.
Erlösung – Die Errettung aus allem Übel, aus Gefahr und Tod. Im Neuen Testament bedeutet Erlösung die Befreiung von der Macht der Sünde und der Strafe für Sünde durch Tod und Auferstehung Jesu.
Erlöser – Im Christentum ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Erlöser. Durch seinen Tod und seine Auferstehung werden die Menschen von der Strafe für die Sünde (ewiger Tod) befreit. ❏
Dieses Bibelstudium erschien zuerst unter dem Titel Foundation of Faith als Beilage von Living Today, der australischen Zeitschrift der GCI.
[2] The Bible – A Guided Tour, S. 4 (Weltweite Kirche Gottes, 1993).
[3] McGrath, Alister E., Christian Theology, An Introduction, S. 207 (Blackwell Publishers, 1994).
[4] Packer, J.I., Concise Theology, S. 3 (Tyndale House Publishers, 1993).
[5] Mears, Henrietta C., What the Bible is All About (New International Version), S. 106 (Regal Books, 1998).
[6] Guthrie, Shirley C., Christian Doctrine (revidierte Ausgabe), S. 271 (Westminster/John Knox Press, 1994).
© Stiftung WKG in Deutschland

