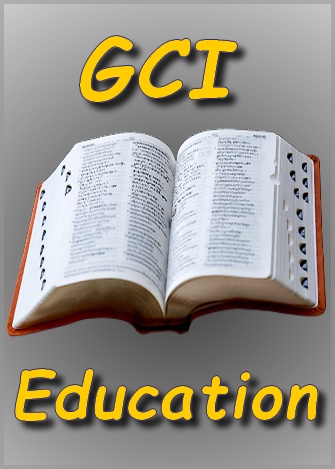
5. Begegnung mit einem Fremden
Was würden Sie tun, wenn ein Ihnen völlig fremder Mensch auf Sie zukommen würde mit den Worten: „Komm mit, folge mir!“? Sehr wahrscheinlich würden Sie ihm oder ihr nicht folgen. Das wäre unvernünftig. Vielleicht wäre Ihre Sicherheit nicht gewährleistet. Wir schärfen unseren Kindern ein, auf keinen Fall mit einem Fremden mitzugehen. Das könnte ein verhängnisvoller Fehler sein.
Und doch gibt es einen Fremden, der Sie auffordert, ihm zu folgen. Sie mögen ihn nicht kennen, aber er kennt Sie. Er kennt sogar Ihr ganzes Leben. Er mag Ihnen fremd sein, Sie aber sind ihm nicht fremd.
Millionen Menschen sind diesem Fremden willig gefolgt, als er in ihr Leben trat. Doch ihre Gefolgschaft beruht nicht auf der Entscheidung, einem Fremden zu folgen. Er ist ihnen nämlich kein Fremder geblieben, sondern zu einem vertrauten Begleiter geworden. Manche Menschen sprechen gar von ihrem „besten Freund“. Sie versichern Ihnen, dass sie diesem Menschen ihr Leben anvertrauen, obgleich sie ihn nie gesehen haben. Denn er ist ihnen nicht mehr fremd. Sie kennen ihn – Jesus.
Und wie steht es mit Ihnen? Können Sie sagen, dass Sie ihn kennen? Oder dass Sie von ihm wissen? Oder dass Sie nichts von ihm wissen? Woran denken Sie, wenn Sie seinen Namen hören? Wie würden Sie auf die Frage antworten: „Wer ist Jesus?“
In dieser Hauskreis-Bibel-Lektion wollen wir uns bemühen, Jesus ein wenig von solcher Fremdheit zu nehmen, denn das Christentum können wir nur begreifen, wenn wir Jesus Christus kennen gelernt haben. Auf ihn geht die Bezeichnung „christlicher Glaube“ zurück. Zu Recht, denn er ist der Begründer des christlichen Glaubens in der Lehre wie im alltäglichen Leben.
„Das Wesentliche am Christentum sind weder Glaubensüberzeugungen noch Verhaltensmuster. Wesentlich ist hier und jetzt der Vollzug der Gemeinschaft mit dem lebendigen Begründer des Christentums, dem Mittler, Jesus Christus.“ [1]
Nachstehend ist wiedergegeben, wie Jesus sich selbst beschrieben hat.
Das Johannes-Evangelium enthält eine Reihe von „Ich bin“-Aussagen. So sagt Jesus: „Ich bin
... das Brot des Lebens
... das Licht der Welt ... die Tür
... der gute Hirte
... die Auferstehung und das Leben
... der Weg und die Wahrheit und das Leben
... der wahre Weinstock“
(Joh. 6,35; 8,12; 10,7; 10,11; 11,25; 14,6; 15,1).
Wer ihm nachfolgte – Menschen, die zu seiner Zeit oder unmittelbar danach lebten und von ihm berichteten – war sich dessen bewusst, dass Jesus nicht nur Mensch war:
„Mein Herr und mein Gott“, rief sein Jünger Thomas aus (als der „ungläubige Thomas“ bekannt) – (Joh. 20,28).
„Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn“, sagte Simon Petrus (Matth. 16,16).
Während Jesus durch die Straßen in Judäa und Galiläa zog, warteten die Juden auf einen Messias. Die Propheten hatten gesagt, ein von Gott Gesandter würde kommen, um sie zu erlösen. Sie waren bei vielen Gelegenheiten enttäuscht worden. Aus dem Gefängnis heraus schickte ein unsicherer Johannes der Täufer seine Jünger und ließ Jesus fragen: „Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen andern warten?“ Und Jesus antwortete: „Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht: Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf, und Armen wird das Evangelium gepredigt“ (Matth. 11,2-5).
Doch trotz der großen und guten Werke, die Jesus tat, wendeten sich viele Leute gegen ihn – besonders die religiösen Anführer, die sich im Alten Testament bestens auskannten und meinten, sie wären im Besitz der Worte des Lebens. Einmal sagte Jesus zu ihnen: „Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin; und sie ist’s, die von mir zeugt; aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet“ (Joh. 5,39-40).
Auch das Neue Testament legt Zeugnis ab von diesem Messias. Aber nun wird sein Name genannt: „Jesus“.
„Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert, zu predigen das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift, von seinem Sohn Jesus Christus, unserm Herrn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch, und nach dem Geist, der heiligt, eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft durch die Auferstehung von den Toten“ (Röm. 1,1-4).
Gelegentlich werden Sie zu hören bekommen, man wolle Jesus durchaus als großartigen Moralisten, als weisen Führer, als guten Menschen oder Propheten anerkennen, aber mehr nicht. Wer so redet, will Jesus bereitwillig in den Bücherschrank stellen, als ehrenwerte Quelle, auf die man bei Gelegenheit zurückgreifen kann, gleich neben die großen Philosophen, Denker, Erfinder und Autoritäten der Geschichte. Aber die Auffassung, Jesus sei zu verehren und anzubeten, sei „Gott mit uns“ oder unser Heiland und Erlöser – nein, das wäre eher eine Zumutung. Aber genau das ist der Punkt, mit dem sich jeder auseinandersetzen muss, der erfahren will, wer Jesus Christus ist.
Der bekannte christliche Autor C. S. Lewis hat diesen Aspekt in seinem Klassiker „Mere Christianity“ (Pardon, ich bin ein Christ) unverblümt angesprochen:
Ich möchte unbedingt verhindern, dass einer das dumme Zeug redet, was die Leute oft über ihn sagen: ,Ich bin bereit, Jesus als großartigen Moralisten anzuerkennen, aber seinem Anspruch, Gott zu sein, kann ich nicht folgen.‘ Genau das dürfen wir nicht sagen.
Ein Mann, der nur ein Mensch war und Reden führte, wie Jesus es getan hat, wäre kein großartiger Moralist. Er wäre entweder ein Geistesgestörter – in dem Sinne, wie einer von sich behauptet, er sei ein Spiegelei – oder der Teufel in Person.
Sie müssen sich entscheiden. Entweder war, und ist, dieser Mann der Sohn Gottes; oder er ist ein Verrückter oder etwas noch Schlimmeres.
Sie können ihn als Idioten mundtot machen, Sie können ihn anspucken und als Dämon töten;
oder Sie können ihm zu Füßen fallen und ihn Herrn und Gott nennen. Aber hüten wir uns vor diesem gönnerhaften Unsinn, er sei ein großartiger Lehrer der Menschheit. Diese Option hat er uns nicht gelassen. Das war nicht seine Absicht.“ [3]
In der Tat: Was Jesus über sich selbst gesagt hat, was diejenigen, die ihn persönlich kannten, über ihn gesagt haben, was diejenigen, die ihm nachfolgten, gesagt haben, und was seine Lebensgeschichte aussagt – all das verlangt von uns, dass wir aufmerksam werden und reagieren.
Man spricht von „der größten Geschichte schlechthin“ – aus gutem Grund. Jesus wurde als Sohn einer Frau namens Maria und des ihr anverlobten Mannes Josef in Bethlehem um das Jahr 4 v. Chr. geboren. Die Familie floh nach Ägypten, als das Leben des Neugeborenen bedroht wurde. Offenbar wuchs Jesus im Geschäft seines Vaters Josef, eines Zimmermanns, heran. Im Alter von zwölf Jahren blieb Jesus während eines Aufenthalts der Familie in Jerusalem hinter den anderen zurück, um sich mit den Hohenpriestern im Tempel zu unterhalten – sie waren verwundert über seinen Verstand und sein Wissen. Als Jesus, der Zimmermann aus Nazareth, etwa dreißig Jahre alt war, trat er erstmalig auf ungewöhnliche Weise öffentlich in Erscheinung. Seine Lehren sind anders als alles, was die Leute bisher zu hören bekommen hatten. Er lehrt die Menschen, einander zu lieben, er erzählt von einem Königreich, er tröstet
die Leidenden, er wendet sich den Außenseitern der Gesellschaft zu, er gibt den Hungrigen zu essen.
Aber das Wirken Jesu beinhaltet mehr als nur gute Worte und gute Taten. Sein erster öffentlicher Auftritt scheint ein Wunder gewesen zu sein: Er verwandelte anlässlich einer Hochzeit Wasser in Wein. Ein Wunder. Wunder begegnen uns in unserem Leben nicht eben häufig – allenfalls in Situationen wie dieser: Eine Sportmannschaft droht zu verlieren und schlägt dann doch noch einen hoch eingeschätzten Gegner, und dann fällt die Bemerkung, dieser Sieg sei „ein Wunder“. Eine solche Situation bietet uns keinen schlechten Einstieg für das Verständnis von Wundern als Ereignissen, die allen Erfahrungen und Naturgesetzen widersprechen.
„Ein Wunder ist ein beobachtetes Ereignis, das uns die Gegenwart und Macht Gottes bewusst werden lässt“, sagt der Theologie-Professor und Autor J. I. Packer. [4] In einer Welt, die sich mit ihrer Rationalität brüstet, können Wunder schon ein wenig verwirren. Doch das Leben Jesu konfrontiert uns mit der Gegenwart des Wundersamen und Übernatürlichen – angefangen mit seiner Geburt.
Theologen bezeichnen die Geburt Jesu als „Inkarnation“ (wörtlich: Fleisch- oder Menschwerdung), um damit zum Ausdruck zu bringen, auf welch wundersame Weise sich der Schöpfergott zu einem natürlichen Teil seiner Schöpfung gemacht hat. Das Leben Jesu auf Erden endete mit einem weiteren Wunder – mit der Auferstehung von den Toten. Um der Menschheit die Gegenwart und die Macht Gottes zu Bewusstsein zu bringen, begann auf wundersame Weise ein von Wundertaten bestimmtes und begleitetes Leben, das in einem Wunder ohnegleichen seinen Höhepunkt erreichte.
Diese Wunder – die Menschwerdung Gottes und die Auferstehung – machen jedem Einzelnen von uns die Gegenwart Gottes in aller Deutlichkeit bewusst. Sie sind für den christlichen Glau- ben von zentraler Bedeutung. Die Heilige Schrift enthält zu beiden Wundern ausführliche Berichte.
„Die Geburt Jesu Christi geschah aber so: Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids [David war einst König des Volkes Israel], fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen; denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden“ (Matth. 1,18-21).
Im Lukas-Evangelium wird berichtet, dieses Wunder sei zu der Zeit geschehen, als „ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war ... Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. Und als sie dort waren ... gebar [sie] ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge“ (Luk. 2,1-7).
„Was immer die Berichte von der Geburt Jesu noch zu bedeuten haben – sie heben hervor, dass der christliche Glaube ,Gott mit uns‘ (Matth. 1,23) nicht lediglich eine schöne Idee oder eine abstrakte theologische Wahrheit ist. Sie ist Wirklichkeit geworden“, schreibt Shirley Guthrie in Christian Doctrine. „[Der Apostel] Johannes berichtet von diesem Geschehen, wenn er sagt, ,das Wort‘ [die Mitteilung Gottes, denn Gott war das Wort] ward Fleisch und wohnte unter uns’ (Joh. 1,1-14). Aber Matthäus und Lukas führen näher aus, dass dieses Geschehen an einen bestimmten Zeitpunkt, an einen bestimmten Ort und an eine bestimmte Mutter gebunden war.“ [5]
Damit erfüllte sich zugleich eine jahrhundertealte Prophezeiung: „Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: ‚Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben’, das heißt übersetzt: Gott mit uns“ (Matth. 1,22-23).
Die Bibel enthält viele tiefgründige und anspruchsvolle Aussagen, doch keine stellt uns wohl vor eine größere Herausforderung als der folgende Abschnitt aus dem Johannes- Evangelium:
„Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen ... Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn gemacht; aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum; und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit“ (Joh. 1,1-4. 9-14).
Der in diesem Abschnitt genannte Anspruch ist das Herzstück des christlichen Evangeliums: Der Schöpfergott kam zu einem bestimmten Zeitpunkt zu uns als einer von uns – ganz Fleisch und Blut – und lebte auf Erden unter den von ihm erschaffenen Menschen. Der Evangelist legt zusammen mit anderen Zeitgenossen persönlich und realistisch Zeugnis ab: „Wir sahen seine Herrlichkeit ...“
Die Berichte der vier Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes verdeutlichen vier maßgebliche Sichtweisen oder Aspekte vom Leben Jesu auf Erden. So schreibt Henrietta Mears:
„König – Matthäus stellt Jesus als König dar. Sein Evangelium hatte er in erster Linie für die Juden geschrieben, denn Jesus ist der Sohn Davids. Seine königliche Abstammung wird in Kapitel 1 genannt. In den Kapiteln 5 bis 7 – in der Bergpredigt – erfahren wir die öffentliche Erklärung des Königs zu den Gesetzen in seinem Königreich.
Diener – Markus beschreibt Jesus in seinem für die Römer verfassten Bericht als Diener und nennt keinen Stammbaum. Warum? Die Menschen sind an dem Stammbaum eines Dieners nicht interessiert. Dagegen werden im Markus-Evangelium mehr Wunder berichtet als in den anderen Evangelien. Die Römer hielten weniger von Worten als vielmehr von Taten.
Mensch – Lukas schildert Jesus als den vollkommenen Menschen. Sein Evangelium richtete sich an die Griechen; er verfolgt die Abstammung Jesu zurück bis zu Adam als dem ersten Menschen und nicht nur bis zu Abraham [wie im Matthäus-Evangelium]. Als vollkommener Mensch wird Jesus an vielen Stellen dargestellt, im Gebet vertieft und umgeben von Engeln, die ihm zu Diensten sind.
Gott – Johannes berichtet von Jesus als dem Sohn Gottes. Sein Evangelium ist für alle Gläubigen geschrieben in der Absicht, die Menschen zu Christus hinzuführen (Joh. 20, 31); alles in diesem Evangelium veranschaulicht überzeugend das göttliche Wesen Jesu.“ [6]
König, Diener, Mensch, Gott. Jede dieser Messias-Bezeichnungen war schon im Alten Testament prophezeit worden: Jesus hat sie auf Erden mit Leben erfüllt. Das Wunder seines Lebens hat das Leben anderer Menschen machtvoll berührt. „Und Jesus zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und die Kunde von ihm erscholl durch ganz Syrien. Und sie brachten zu ihm alle Kranken, mit mancherlei Leiden und Plagen behaftet, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte; und er machte sie gesund. Und es folgte ihm eine große Menge aus Galiläa, aus den Zehn Städten, aus Jerusalem, aus Judäa und von jenseits des Jordans“ (Matth. 4,23-25).
Er gab Tausenden von Menschen Speise, die ihm in eine einsame Gegend gefolgt waren, um ihn predigen zu hören: Sie wurden satt von fünf Broten und zwei Fischen (Matth. 14; Mark. 6; Luk. 9; Joh. 6).
Er verwandelte auf einem Hochzeitsfest Wasser in Wein (Joh. 2).
Er wandelte auf dem Wasser (Matth. 14; Mark. 6; Joh. 6) und stillte einen Sturm (Mark. 4; Matth. 8; Luk. 8).
Er berührte und heilte „unreine“ Aussätzige (Matth. 8; Mark. 1; Luk. 5); Gelähmte (Matth. 9; Mark. 2; Luk. 5, 13; Joh. 5), Blinde (Matth. 9, 20; Mark. 8; Luk. 18; Joh. 9) und Besessene (Matth. 12; Mark. 1; 5; 9; Luk. 4; 8; 9).
Bei einem dieser Anlässe, als Jesus einen von einem Dämon besessenen Menschen heilte, forderten ihn die religiösen Anführer mit den Worten heraus, seine Macht zum Austreiben der bösen Geister käme vom Satan selbst. Jesus antwortete: „Wenn nun der Satan den Satan austreibt, so muss er mit sich selbst uneins sein; wie kann dann sein Reich bestehen? ... Wenn ich aber die bösen Geister durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen“ (Matth. 12,26-28).
„Das Reich Gottes ist zu euch gekommen.“ Mit dieser Antwort macht Jesus unmissverständlich klar, dass seine (königliche, göttliche) Gegenwart unter uns Menschen eine neue Ordnung einleitete (wenngleich in der Gestalt eines Dieners und Menschen). Nichts würde je wieder sein, wie es war. Seine Geburt, seine Lehren und seine Wunder waren Manifestationen dieser Botschaft „Gott mit uns“. Jesus hat es selbst gesagt: Welche andere Erklärung könnte es geben?
Die machtvolle Botschaft, die von den Wundern Jesu ausgeht und die Gegenwart Gottes in der Welt offenbart, wird noch von einer weiteren Botschaft auf wunderbare Weise begleitet. Genauso machtvoll in ihrer Tragweite, aber völlig unerwartet, ist die Botschaft der Nächstenliebe, der Anteilnahme und des gegenseitigen Annehmens, die Jesus im Umgang mit den Menschen vermittelt hat. Das wundersame Bild des allmächtigen, majestätischen, unendlichen Gottes, aus dem Himmel herabgestiegen, um inmitten seiner Schöpfung zu leben, wird erweitert durch die Erfahrung, dass Gott aus Zuneigung unter uns weilt! Für viele war das schwer zu begreifen: Wie konnte ein Messias, ein Erlöser, ein Herrscher, ein König so „realitätsnah“ sein?
Das war etwas Unerwartetes, Schockierendes und Verwirrendes. Und letztlich war es auch etwas Unannehmbares für viele, die doch zu wissen meinten, wie der Messias aussehen „sollte“. Ein immer wiederkehrendes Sinnbild von Jesu Leben auf Erden ist die liebevolle Hingabe, in der er mit anderen Menschen – ungeachtet ihrer Herkunft – zu Tisch sitzt, gemeinsam mit ihnen speist und Trost spendet.
„Bezeichnend für Jesu Zuwendung zu den Menschen war die Tatsache, dass er eine Tischgemeinschaft pflegte, von der grundsätzlich niemand ausgeschlossen war und die keine hierarchische Ordnung kannte. Es war ihm ein zentrales Anliegen, seiner Verkündung und Neudefinition der anbrechenden Gottesherrschaft auf diese Weise Nachdruck zu verleihen und Exklusivität und Statusdenken in den traditionellen sozialen und religiösen Sitten in Frage zu stellen.“ [7]
Wir sehen Jesus auf dem Hochzeitsfest (einem Ereignis, das sich normalerweise über eine ganze Woche erstreckte); wir erfahren, wie er in das Haus eines Zöllners geht und mit ihm zu Tisch sitzt (Zöllner waren wegen ihrer korrupten Machenschaften verhasst); wie er sich zum Essen niedersetzt, ohne die nach religiöser Sitte vorgeschriebenen Waschungen einzuhalten; wie er das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern teilt; wie er nach seiner Auferstehung am Seeufer Fisch für sie zubereitet. Einmal entrüstete er seine religiösen Gastgeber, als er zuließ, dass ihm eine Prostituierte die Füße mit Öl salbte, während er zu Tisch saß (Luk. 7, 36-39). Seine Gewohnheit, mit anderen zu Tisch zu sitzen, war so ausgeprägt, dass er der „Völlerei und Trunksucht, der Freundschaft mit Zöllnern und Sündern“ beschuldigt wurde! Doch Jesus suchte auch über die Tischgemeinschaft hinaus die offenkundige Verbindung zu gesellschaftlich geächteten Menschen und zeigte ihnen seine Anteilnahme – Aussätzigen, einer Ehebrecherin, einer (von den Juden verachteten) Samariterin. Vor zweitausend Jahren erregte Jesus öffentliches Ärgernis: An seiner ungezwungenen, freundlichen, mitfühlenden Art, die ihm selbst nur natürlich erschien, nahmen viele seiner Zeitgenossen Anstoß.
„Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause [des Zöllners Matthias], siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer [die religiösen Anführer] sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er: Die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt: ‚Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer.‘ Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten“ (Matth. 9,10-13).
Jesus ist gekommen, damit wir Gott erkennen und erfahren, wer er ist und wie er wirklich ist – auf eine gänzlich unerwartete Weise. Gott ist nicht mehr „irgendwo da oben“; er ist jedem Einzelnen von uns nah. Er kennt uns, er liebt uns und er will von uns erkannt sein. Das ist die gute Nachricht, die Jesus uns gebracht, gelehrt und auf Erden gelebt hat.
In unserer nächsten Folge wollen wir uns mit der Frage befassen, was uns Jesus als „Herr und Erlöser“ sagt, was Tod und Auferstehung Jesu und seine Lehren über „das Reich Gottes“ bedeuten und welche Tragweite dies alles für unser jetziges Leben und darüber hinaus hat.
- Sie haben über Jesu Leben und sein priesterliches Amt gelesen. Wie reagieren Sie persönlich auf: Die Lebensgeschichte? Die Person? Die Jesus zugeschriebenen Werke?
- Welchen Fakten, Ereignissen, Behauptungen oder Lehren in Jesu Leben messen Sie die größte Bedeutung bei?
- Fällt es Ihnen schwer anzuerkennen, dass Jesus „Gott in Menschengestalt“ war? Wenn ja, warum? Wenn nicht, warum nicht?
- Wie würden Sie die Bedeutung Jesu in unserer Welt beschreiben?
- Wie würden Sie die Bedeutung Jesu für Ihr eigenes Leben einschätzen?
Wir möchten Ihnen empfehlen, eine dem modernen Sprachgebrauch angepasste Bibel (zum Beispiel den Bibeltext in der revidierten Fassung der Lutherbibel, herausgegeben von der Deutschen Bibelgesellschaft Stuttgart, 1984) zu wählen und die Berichte der vier Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes nachzulesen. (Sie haben die Evangelien schon gelesen? Tun Sie es ruhig noch einmal!) Bei Ihrer Lektüre sollten Sie versuchen, mit Ihren eigenen Worten zusammenzufassen, was der Evangelist über Jesus mitteilen will.
„Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“ – Johannes 3, 16 –
Salben – Das Einreiben oder Begießen mit Öl war ein Zeichen für die Aussonderung eines Menschen für einen bestimmten Zweck.
Inkarnation – Wörtlich bedeutet Inkarnation „Fleischwerdung“. Im religiösen Kontext bezieht sich Inkarnation auf die Doktrin, dass Gott in der Person Jesu Christi Menschengestalt angenommen hat. Damit ist aber nicht gemeint, dass Gott während dieses Prozesses seine Göttlichkeit aufgegeben hätte.
Reich Gottes – Der Ausdruck verweist auf die Herrschaft Gottes in der Welt.
Mittler – Ein Mittler vermittelt zwischen mehreren Parteien, um eine Einigung zu erzielen. Jesus ist gekommen, um die Menschheit mit Gott zu versöhnen.
Erlöser – Für Christen ist Jesus Christus der Sohn Gottes, dessen Tod und Auferstehung die Menschen aus der Entfremdung von Gott erlöst.
Theologe – Das Wort Theologie ist von dem griechischen Wort theologia abgeleitet und bedeutet „die Erforschung Gottes“. Ein Theologe ist somit ein „Gottesgelehrter“. ❏
Dieses Bibelstudium erschien zuerst unter dem Titel Foundation of Faith als Beilage von Living Today, der australischen Zeitung der WKG.
[2] Johannes 14,6.
[3] Lewis, C. S., Mere Christianity (Pardon, ich bin ein Christ) .
[4] Packer, J. I., Concise Theology (Tyndale House, 1993), S. 57.
[5] Guthrie, Shirley C., Christian Doctrine (überarb. Ausgabe) (Westminster/John Knox Press, 1994).
[6] Mears, Henrietta C., What the Bible is All About, New International Version (Regal Books, 1998), S. 365-366.
[7] Dictionary of Jesus and the Gospels (Intervarsity Press, 1992), S. 796.
© Stiftung WKG in Deutschland

