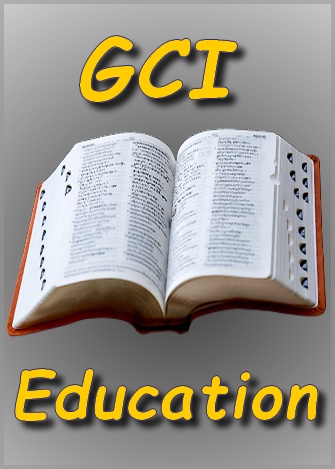
6. Warum Jesus die gute Nachricht ist
„Das süße kleine Baby dort in der Krippe, umgeben von Hirten und Engeln, wuchs heran zu einem radikalen, subversiven Prediger, der umso gefährlicher war, als er behauptete, dass das, was er sagte und tat, das sei, was Gott sagt und tut. Jesus war nicht nur der Freund der Sünder; er wagte es, ihnen ihre Sünden zu vergeben, und damit erhob er den Anspruch, das tun zu können, wozu nur Gott ein Recht hat.“ [1]
Und deshalb töteten sie ihn. „Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an und traten zu ihm und sprachen: Sei gegrüßt, König der Juden! und schlugen ihm ins Gesicht. Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen: Seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Und Jesus kam heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus spricht zu ihnen: Seht, welch ein Mensch! Als ihn die Hohenpriester und die Knechte sahen, schrien sie: Kreuzige! kreuzige! Pilatus spricht zu ihnen: Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht“ (Joh. 19,1-7).
Vier Jahrhunderte vor Jesus hatte der Philosoph Sokrates gesagt, ein wahrhaft gerechter Mensch sei für die Gesellschaft so unannehmbar, dass man ihn töten müsse. Seine Feststellung erwies sich als zutreffend. Doch Jesu Tod ist nur ein Teil der Geschichte. Jesu Leidensgeschichte hat sich zu einer Heilsbotschaft gewandelt. Der Bericht von Jesu Erniedrigung ist zum Siegeszug geworden. Mit dem Tod Jesu wurde neues Leben verkündet. Wie ist das zu verstehen?
„Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren“ (Röm. 5,8). Warum? Warum musste ein so offenkundig guter Mensch wie Jesus leiden und einer schmerzvollen, erniedrigenden Kreuzigung – dem Tod am Kreuz – überantwortet werden? Und warum starb er ausgerechnet für Sünder? Worum geht es?
Ein flüchtiger Blick in die Zeitung oder auch auf die Nachrichtensendungen im Fernsehen bestätigt, was uns die Bibel sagt: Die Menschen „kennen den Weg des Friedens nicht“ (Jes. 59,8-9). Die Bibel berichtet vom – vergeblichen – Kampf der Menschen, das Leben zu bewältigen. Irgendetwas stimmt nicht mit uns. Irgendetwas ist zerbrochen. Irgendetwas bedarf dringend einer Reparatur. Doch genau dies können wir aus uns selbst heraus nicht leisten. Man nennt es „Sünde“. Um der Sünde – unserer Sünde – willen ist Jesus am Kreuz gestorben. Wir können dieses Geschehen nur begreifen, wenn wir klar erkennen, wer Jesus war – und ist.
Wie aus unserem einleitenden Zitat deutlich wird, war Jesus gewiss keine Märchenfigur, die nur als Kind in einer Krippe, umgeben von anbetenden Engeln und Hirten, Bestand gehabt hätte. Seine Lebensgeschichte und seine Lehren kennzeichnen ihn als höchst einzigartig: als radikalen Lehrer, als Propheten, als König, als Priester. Dies alles war er, aber er war noch mehr – er war „Gott mit uns“: Immanuel (Jes. 7,14; Matth. 1,22-23).
Dieses „Gott mit uns“ ist von zentraler und grundlegender Bedeutung für den christlichen Glauben. In diesem Punkt hat die Kirche über Jahrhunderte hinweg epische Schlachten mit Häretikern ausgetragen. (Häresie ist eine Lehre, die in unmittelbarem Widerspruch zu den Lehren der Bibel steht und sich damit der von Gott offenbarten Wahrheit widersetzt.) So haben Häretiker immer wieder zu leugnen versucht, dass Jesus wirklich „Gott mit uns“ – Gott in Menschengestalt – war. Dies aber ist die eindeutige Aussage der Heiligen Schrift; in früheren Ausgaben unseres Bibelstudiums haben wir verschiedentlich darauf hingewiesen (siehe Joh. 1,1-14). Über alle Zeit hinweg haben Christen die Worte des „ungläubigen“ Thomas wiederholt, der, selbst Jünger Jesu, ausrief: „Mein Herr und mein Gott!“ (Joh. 20,28). Und der Apostel Paulus schrieb: „Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm [Jesus] alle Fülle wohnen sollte“ (Kol. 1,19).
Im Apostolischen Glaubensbekenntnis heißt es: „[Ich glaube] ... an Jesus Christus, seinen [Gottes] eingeborenen Sohn, unsern Herrn ...“ [2]
„Es ist kein Zufall, dass der Abschnitt über Christus der längste Abschnitt im Glaubensbekenntnis ist“, sagt Shirley C. Guthrie. „Diese zentrale Doktrin verleiht allen anderen ihre inhaltliche Bedeutung. Alle Lehrsätze des christlichen Glaubens sind auf Christus bezogen wie Speichen auf die Radnabe. Es wäre uns unmöglich, darüber zu reden, wer Gott ist, wie wir Gott erfahren, wie Gott in Erscheinung tritt und was Gott mit uns vorhat, wenn wir nicht zugleich über die Selbstoffenbarung Gottes in Christus reden. Und wir könnten auch nicht darüber reden, was es bedeutet, menschliche Wesen ‚zum Bilde Gottes’ und zugleich Sünder zu sein, die im Widerspruch zur eigenen Menschlichkeit handeln, wenn wir nicht auch über Jesus reden ... Der christliche Glaube eines Menschen steht und fällt mit dem, was er in Bezug auf Jesus glaubt.“ [3]
Wir glauben das, was uns Johannes, der Jünger Jesu, eindringlich verdeutlichen will: „dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes ...“ (Joh. 20,31). Er wiederholt lediglich, was er seinen Herrn selbst hat sagen hören: „Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet ...“ (Joh. 3,16-18).
Gott sandte Jesus, damit „die Welt durch ihn gerettet werde“. Warum? Weil Gott „die Welt geliebt“ hat. Matthäus schreibt, Jesus sei gekommen, um die Menschen von ihren Sünden zu erretten (Matth. 1,21). Im Lukas-Evangelium heißt es: „Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids“ (Luk. 2,11). Und an anderer Stelle: „Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist“ (Luk. 19,10). Aber warum musste Jesus sterben?
„Weil Gott zu sehr an uns Anteil nimmt, als dass er unsere Sünde und Schuld gleichgültig abtun könnte. Weil Worte nicht ausreichten: Es musste gehandelt werden, um die Wahrhaftigkeit der Liebe und Vergebung Gottes zu beweisen. Weil Gott uns beistehen wollte in der Einsamkeit und Entfremdung, die wir uns selbst auferlegen, wenn wir uns von Gott und unseren Mitmenschen abwenden. Weil unsere Einsamkeit, Entfremdung und Schuld nur durch diesen Beistand Gottes zu überwinden sind. Am Kreuz sagt Gott zu uns: ‚Ja, es ist wahr. Ihr habt mich verletzt und gekränkt. Aber ich liebe euch dennoch. Deshalb nehme ich eure Schuld in aller Konsequenz auf mich. Ich will mit euch – für euch – leiden, um die Beziehung zwischen uns wiederherzustellen.“ [4]
Jesu Leiden und Tod am Kreuz soll uns in alle Ewigkeit an zwei Dinge erinnern, die für die menschliche Erfahrung von allerhöchster und unergründlicher Bedeutung sind.
„Sünde“ ist heutzutage ein eher verwirrender Begriff. Wir machen unsere Scherze und sagen, wir hätten „gesündigt“, weil wir zu viel Schokolade gegessen hätten. Und selbst wenn wir bestimmte Verhaltensweisen als Sünde ansehen, so würden sich die meisten Leute gegen eine Etikettierung als „Sünder“ sträuben. Doch wenn wir die Bibel als das inspirierte Wort Gottes – als die Mitteilung Gottes an uns – anerkennen wollen, müssen wir uns mit der Problematik der Sünde und der Sündenlast auseinandersetzen.
„Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten“, schreibt Paulus in seinem Brief an die Römer (3,23). „Allesamt“. Jeder. Und es kommt noch schlimmer: „Der Sünde Sold ist der Tod“, heißt es an späterer Stelle (Röm. 6,23). Das ist ernst.
Die Bibel lehrt uns, wir seien „zum Bilde Gottes“ geschaffen worden (1. Mose 1,27), nach Gottes eigenem Plan und Willen. Und sie berichtet, dass etwas vorgefallen ist, was diese besondere Schöpfung verletzt, beschädigt und zerbrochen hat.
„Wir sind Abbilder und Geschöpfe Gottes, ausgestattet mit einer einzigartigen Fähigkeit, das Wesen Gottes widerzuspiegeln und zu reflektieren. Beim Sündenfall ist etwas Schreckliches geschehen. Das Bild Gottes ist stark getrübt worden. Unsere Fähigkeit, seine Heiligkeit widerzuspiegeln, ist stark beeinträchtigt worden, und nun ist der Spiegel trübe. Doch der Sündenfall hat nicht unsere Menschlichkeit zerstört. Obgleich unsere Fähigkeit zur Reflektion der Heiligkeit Gottes mit dem Sündenfall verlorengegangen ist, sind wir dennoch menschliche Wesen. Wir haben dennoch Verstand, Herz und einen Willen. Wir tragen dennoch das Zeichen unseres Schöpfers.“ [5]
Sünde ist umfassend zu beschreiben als alles, was dem Willen Gottes zuwiderläuft. „Die Heilige Schrift erkennt Sünde als universelle Entartung der menschlichen Natur, wie sie bei jedem Menschen allerorts anzutreffen ist (1. Kön. 8,46; Röm. 3,9-23; 7,18; 1. Joh. 1,8-10). Beide Testamente verwenden Umschreibungen für Sünde, die jede ethisch-moralische Entartung brandmarken als Rebellion gegen die Gottesherrschaft, als Verfehlung des von Gott vorgegebenen Ziels, als Überschreitung des Gottesgesetzes, als Ungehorsam gegenüber den Anweisungen Gottes, als Kränkung der Reinheit Gottes durch Selbstbeschmutzung und als Verschuldung vor Gott als dem Richter. Diese moralische Entartung ist ein dynamischer Prozess: Sünde offenbart sich als die Energie einer irrationalen, negativen und rebellischen Reaktion auf Gottes Ruf und Befehl, als kämpferische Geisteshaltung Gott gegenüber in dem Bestreben, selbst Gott zu spielen.“ [6]
Das ist es, was uns die Geschichte von Adam und Eva und der verbotenen Frucht sagen will: Die Menschheit hat sich von Anbeginn an die Freiheit genommen, sich dem Willen und der Autorität Gottes zu widersetzen. Darauf bezieht sich der Ausdruck „Erbsünde“. Dieses Wort kommt in der Bibel nicht vor, verdeutlicht aber den Zustand der Menschheit im Sinne des unmissverständlichen Prinzips, wie es vom Apostel Paulus erläutert wurde: „Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben ...“ (Röm. 5,12).
Die biblischen Berichte – wie auch die übrige Menschheitsgeschichte – sind eine traurige Bilanz dessen, wie ungöttlich sich die Menschen untereinander verhalten, unabhängig von Umständen, Zeit oder Kultur.
Im Zusammenhang mit Sünde wird in der Bibel häufig auf den „Zorn“ Gottes verwiesen. „Zorn“ ist ebenfalls ein eher altmodisches Wort. Aber es ist ein wichtiges Wort, wenn es um die Beziehung zwischen Mensch und Gott geht. Der Apostel Paulus berichtet, wir seien alle „Kinder des Zorns [Gottes] von Natur“ (Eph. 2,3).
„Zorn ist bei Gott keine launische, mutwillige, kindische, unmoralische Angelegenheit“, schreibt J. I. Packer in Knowing Christianity. „Zorn ist das moralische und als göttliche Strafe verhängte Attribut, wie es in einem gerechten Urteil zum Ausdruck gebracht wird. Zorn ist Heiligkeit, die Sünde zurückweist.“ [7]
Wir gewöhnen uns derart an unsere menschlichen Schwächen, Fehler und Verfehlungen, dass wir uns schließlich von der moralischen Entartung des menschlichen Zustands gar nicht mehr beeindrucken lassen. „Es ist halt so, wie es ist“, reden wir uns ein. Und doch ist dies nicht ein Zustand, den ein heiliger Gott duldet. Gott weist diesen Zustand zurück. Wir mögen uns damit begnügen – er nicht.
Wenn es nicht noch etwas darüber hinaus gäbe, dann hätte Shakespeares Macbeth auf schauerliche Weise Recht:
Leben ist nur ein wandelnd Schattenbild,
Ein armer Komödiant, der spreizt und knirscht
Sein Stündchen auf der Bühn und dann nicht mehr
Vernommen wird; ein Märchen ists, erzählt
Von einem Blödling, voller Klang und Wut,
Das nichts bedeutet.
(William Shakespeare, Gesammelte Werke, Fünfter Band, Bertelsmann Lesering, S. 514)
Doch glücklicherweise ist damit nicht das Schlusswort gesprochen. Jesu Leiden und Sterben am Kreuz erinnert uns nicht nur an die Problematik der Sünde, sondern zugleich an eine völlig unerwartete göttliche Lösung dieser Problematik.
„Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben ein für alle Mal ...“ – Römer 6,10 –
„Der Sünde Sold ist der Tod“, sagt uns die Bibel. Aber diese Aussage wird sogleich fortgeführt mit den Worten: „Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserm Herrn“ (Röm. 6,23). In seinem Brief an die Epheser schrieb Paulus, wir seien alle „Kinder des Zorns [Gottes] von Natur“ (Eph. 2,3). Das ist für uns wohl die schlimmste aller Nachrichten. Doch die gute Nachricht folgt: „Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht – aus Gnade seid ihr selig geworden“ (Verse 4-5).
Dem Wort „Gnade“ kommt im Evangelium zentrale Bedeutung zu. „Gnade“ bedeutet das unverdiente Entgegenkommen Gottes, Sündern, die sich ihm zuwenden und ihn suchen, Barmherzigkeit und Vergebung zuteilwerden zu lassen. Gnade ist der höchste Ausdruck von Liebe. Trotz unserer Missachtung seiner Vollkommenheit will unser Schöpfergott uns vergeben, uns retten, uns das Leben geben, zu dem er uns erschaffen hat. Und deshalb hat er sich zu unserem Erlöser – unserem Retter – gemacht. Und zu unserem persönlichen Opfer, um den schrecklichen Preis für unsere Sünde zu zahlen.
Das Kreuz Jesu Christi – der ungehobelte, splittrige, blutbefleckte Holzbalken, an den sein geschlagener und geschundener Körper bis zum letzten Atemzug genagelt war – erinnert uns eindringlich an dieses Opfer. Der unvermeidliche Sold der Sünde – der Tod – ist von Gott in einem unvergleichlichen Akt der Liebe bezahlt worden.
Die bekannte Ausdrucksweise „Irren ist menschlich, Vergeben göttlich“ ist zutiefst wahr. Diese Botschaft von der Vergebung unserer Sünden ist das Kernstück des Evangeliums. Sie ist „die gute Nachricht“ (in der ursprünglichen Bedeutung von „Evangelium“) von dem, was Gott durch Jesus Christus für uns getan hat. Sie ist die gute Nachricht, dass es uns ermöglicht worden ist, wieder in die heile Beziehung zu Gott treten zu dürfen, für die wir erschaffen wurden. Sie ist die gute Nachricht, dass Leben mehr ist als nur „ein wandelnd Schattenbild, ein armer Komödiant, der spreizt und knirscht sein Stündchen auf der Bühn und dann nicht mehr vernommen wird; ein Märchen ... voller Klang und Wut, das nichts bedeutet“.
Diese gute Nachricht beruht nicht auf einer Leistung, zu der wir hätten beitragen können; sie beruht ausschließlich auf der großen Liebe Gottes zu uns Menschen. „Gott, unser Heiland“, schrieb der Apostel Paulus an Timotheus, „will, dass alle Menschen gerettet werden“ (1. Tim. 2,4). „Er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde“, schrieb einer von Jesu Jüngern – Petrus, der Fischer (2. Petr. 3,9). Und der Apostel Paulus gestand dem jungen Prediger Timotheus: „Das ist gewisslich wahr und ein Wort, des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als erstem alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten zum ewigen Leben“ (1. Tim. 1,15-16).
Obgleich wir uns gegen Gott versündigen, wendet er sich nicht von uns ab. Vielmehr will er uns erlösen, er will die Sünder retten, er zeigt Barmherzigkeit und Geduld. Dies zeugt gewiss von einer Liebe, die alle menschliche Erfahrung übersteigt. Und wir lernen etwas Wichtiges über Gott: „Gott ist die Liebe“, lehrte der Apostel Johannes (1. Joh. 4,16). „Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe: nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsre Sünden ... Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe“ (1. Joh. 4,9-16).
Dieser Gott der Liebe kam zu uns in unser Leben auf Erden, um für uns den Sieg davonzutragen. Und dieser Sieg wird lebendig in Jesu Auferstehung. Dieses einzigartige Geschehen steht im Mittelpunkt des christlichen Glaubens. „Das Christentum beruht auf der Gewissheit, dass die Auferstehung Jesu ein räumlich und zeitlich bestimmtes historisches Ereignis ist“, schreibt J. I. Packer. [8]
Es war ein persönlicher Sieg für jeden Gläubigen: „Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden“, schrieb der Apostel Paulus an die Kirche in Korinth. „Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unsern Herrn Jesus Christus!“ (1. Kor. 15,21-22.57).
Diesen Sieg verdanken wir Jesu vollkommenem Leben, seinem Tod als Sold für unsere Sünden und seiner Auferstehung von den Toten, die uns seine Macht über den Tod verdeutlicht.
„Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe“, schrieb Paulus an die Kirche in Korinth. „Durch das ihr auch selig werdet ... Denn als Erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe: Dass Christus gestorben ist für unsre Sünden nach der Schrift; und dass er begraben worden ist; und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift ...“ (1. Kor. 15,1-4).
„Der Gott, der im christlichen Glauben verehrt wird, ist weder Produkt dieses Glaubens noch die Kreation von Theologen oder Philosophen. Er ist kein Gott, der von menschlichen Wesen erfunden oder entdeckt worden wäre. Er ist der Gott, der von sich aus zu ihnen gesprochen und sich in einer Abfolge von Erlösungswerken bis zur Befreiung Israels aus Ägypten und noch weiter zurück offenbart hat. Gott zeigt sich weder in einem Lehrwerk noch in einem theologischen System oder Buch, sondern durch eine Abfolge von Ereignissen, wie sie in der Bibel berichtet werden. Die Ankunft Jesu von Nazareth war der Höhepunkt dieser Abfolge von Erlösungswerken; und seine Auferstehung ist das Geschehen, das alle vorangegangenen Werke vollstreckt. Wäre Christus nicht von den Toten auferstanden, hätte die lange Abfolge der Erlösungswerke Gottes zur Errettung seines Volkes in einer Sackgasse – im Grab – geendet. Wenn die Auferstehung Christi nicht Realität ist, haben wir keine Gewissheit, dass Gott der lebendige Gott ist, denn dann hat der Tod das letzte Wort. Der Glaube ist vergeblich, weil sich der Gegenstand dieses Glaubens nicht als Herr des Lebens behauptet hat.“ [9]
Doch genau das sagt uns die Auferstehung: Jesus ist der Herr des Lebens; in ihm haben wir das Leben; der Tod hat nicht mehr das letzte Wort.
Der Apostel Paulus schließt seine Ausführungen zur Kernaussage des christlichen Glaubens, indem er die Kirchenmitglieder in Korinth daran erinnert, dass Jesus „gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen [den zwölf Jüngern]. Danach ist er gesehen worden von mehr als fünfhundert Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben ...“ (1. Kor. 15,5-6). Paulus unternimmt nicht einmal den Versuch, die Auferstehung zu „beweisen“; er erinnert die Angesprochenen lediglich an unmittelbar zugängliche Augenzeugenberichte vom auferstandenen Christus.
„Wir wissen, wem das Grab gehörte, in dem man ihn [Jesus] am Freitag beerdigt hatte und das am Sonntag in der Frühe leer aufgefunden wurde. Der Besitzer war zudem kein Unbekannter, sondern ein vornehmer Bürger Jerusalems – Josef von Arimathäa, ein Mitglied des Hohen Rates. Es bestand überhaupt keine Schwierigkeit, ihn ausfindig zu machen und die Fakten zu ermitteln ... Und wir wissen auch, wann, wo und wem sich der auferstandene Jesus zeigte. Knapp zwanzig Jahre nach diesem Geschehen stellte Paulus fest, dass über fünfhundert Leute Jesus bei der einen oder anderen Gelegenheit gesehen hatten, von denen die meisten zu der Zeit, als der Brief an die Korinther geschrieben wurde, noch lebten ... Diese bemerkenswerte Geschichte ist in vielen Punkten leicht nachzuvollziehen. Es geht hier keineswegs um weltmännische Mythen.“ [10]
Sicher – zweitausend Jahre später gerät unsere Überzeugung von der Auferstehung Jesu zwangsläufig zum Glaubensakt. Aber dieser Glaube gründet auf der zuverlässigen Berichter-stattung der Bibel und ihrer zur Zeit der schriftlichen Niederlegung jederzeit überprüfbaren historischen Basis.
Die Botschaft von Jesu Auferstehung von den Toten steht im Mittelpunkt des Evangeliums. Das Kreuz mag ihn getötet haben, aber das Grab konnte ihn nicht halten. Die Botschaft des Christentums ist nicht die von einem tot am Kreuz hängenden Menschen; die Botschaft ist die vom auferstandenen Herrn, der uns ein leeres Grab zurückließ zum Zeichen seines Sieges und seiner Macht über den Tod: Er hat diesen Sieg persönlich und für jeden Einzelnen von uns errungen.
„Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden“ (Kol. 1,13-14). „Er hat uns errettet.“ Jesus ist gekommen, um uns zu erretten, zu befreien, zu heilen, zu erlösen und uns ein neues Leben zu geben. Deshalb ist Jesu Botschaft die gute Nachricht! Jesus ist unser Erlöser. Er ist unser Herr. Die Leere dieses Grabes zählt zu den gesichertsten Fakten der alten Welt. [11]
„Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde.“ –Johannes 3, 16-17 –
In diesem Beitrag sind wir der Frage nachgegangen, warum die Botschaft Jesu die gute Nachricht ist. Überdenken wir noch einmal die wichtigsten Aspekte: die Botschaft des Kreuzes; Gottes Einstellung zur Sünde und seine Reaktion darauf; Gottes Liebe; die Realität des Todes und Gottes Absicht zur Überwindung des Todes um unsertwillen.
• Was haben Sie in diesem Beitrag über Gott erfahren?
• Was haben Sie in diesem Beitrag über sich selbst und über den Zustand der Menschheit erfahren?
• Wie ist Ihre Reaktion auf das, was Gott laut biblischer Berichterstattung für Sie durch Jesus Christus getan hat?
• Lesen Sie mehr über Gottes Liebe und seine Absicht, alle Menschen zur Annahme der Erlösung zu bewegen, die er uns ermöglicht hat: 1. Korinther 15; Brief an die Hebräer. (Im Brief an die Hebräer wird Jesus in erster Linie als Offenbarer und Werkzeug zur Vermittlung der Gnade Gottes gezeigt. Die Darstellung gibt eine historische Sichtweise der Beziehung Gottes zum Volk Israel wieder, verdeutlicht aber „die Erhöhung Christi“.)
• Wiederum empfehlen wir Ihnen, eine dem modernen Sprachgebrauch angepasste Bibel zur Hand zu nehmen – zum Beispiel die revidierte Fassung der Lutherbibel (herausgegeben von der Deutschen Bibelgesellschaft Stuttgart, 1984).
„Und darum ist er auch der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen.“ – Hebräer 9, 15 –
Apostolisches Glaubensbekenntnis – Als knappe Zusammenfassung des christlichen Glaubens zählt dieses Glaubensbekenntnis zu den ältesten christlichen Glaubensbezeugungen.
Buße und Sühne – Buße tun und sühnen heißt, ein Unrecht zu bereuen und wiedergutzumachen. Im vorliegenden Zusammenhang ist die Versöhnung der Menschen mit Gott durch Jesu Leben, Tod und Auferstehung gemeint.
Kreuzigung – Der Tod Jesu Christi erfolgte durch Kreuzigung: Der Körper wurde an einen ungehobelten Holzbalken genagelt, der dann an einem senkrecht im Boden stehenden Pfahl angebracht wurde. Das Opfer wurde meist auch gegeißelt. Diese Strafe wurde nur an Sklaven, Rebellen und schlimmsten Verbrechern vollzogen.
Doktrin – Eine Doktrin ist ein Lehrsatz oder ein System von Prinzipien, das die Basis für die Lehre zu einer Thematik darstellt.
Sündenfall – Mit dem Ausdruck „Sündenfall“ wird die Trennung und Entfremdung der Menschheit von Gott infolge des Ungehorsams von Adam und Eva umschrieben.
Erlösung – Erlösung steht in engem Zusammenhang mit „Ablösung“ oder Tilgung einer Schuld zum Zweck eines „Rückkaufs“: Jesus hat uns zurückgekauft, indem er den Preis für unsere Sünde gezahlt hat.
Errettung – Errettet wird man von einem Übel, aus einer Gefahr oder vor dem Tod. Das Neue Testament zeugt von der Errettung der Menschheit aus der Macht der Sünde und ihrer Bestrafung durch Jesu Tod und Auferstehung. ❏
Dieses Bibelstudium erschien zuerst unter dem Titel Foundation of Faith als Beilage von Living Today, der australischen Zeitschrift derGCI.
[2] Apostolisches Glaubensbekenntnis.
[3] Guthrie, Shirley C., Christian Doctrine (überarb. Ausgabe) (Westminster/John Knox Press, 1994), S. 229.
[4] Ebenda, S. 260.
[5] Sproul, R.C., Essential Truths of the Christian Faith (Tyndale House Publishers, 1992), S. 131-132.
[6] Packer, J. I., Concise Theology (Tyndale House, 1993), S. 82.
[7] Packer, J. I., Knowing Christianity (Harold Shaw Publishers, 1995), S. 77.
[8] Packer, J. I., Concise Theology , S. 126.
[9] Ladd, George Eldon, A Theology of the New Testament (William B. Eerdmans, 1993), S. 353-354.
[10] Barnett, Paul, The Truth About Jesus (Aquila Press, 1994), S. 128.
© Stiftung WKG in Deutschland

