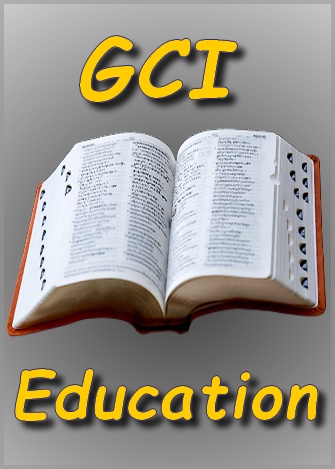
9. Sinn und Zweck – Mehr als nur Zahl oder Nummer
Haben Sie jemals alle Zahlen und Nummern, die für Ihr Leben in der einen oder anderen Weise von Belang sind, aufaddiert? Sie wissen schon: Führerschein-Nummer, Kreditkarten-Nummern, Bankkonto-Nummer, Telefon-Nummer, Steuerkarten-Nummer und so weiter.
Es beginnt mit dem Augenblick unserer Geburt: Unsere Geburtsurkunde trägt eine Registriernummer. Und im Lauf unseres Lebens kommen immer mehr Nummern und Zahlen hinzu: PIN-Nummern (auch wenn eine „persönliche“ Identifikation etwa mit 841-0265-3 kaum vorstellbar erscheint), Auto-Kennzeichen, Kenn-Nummern bei Einbruchsalarm, sonstige Kennzahlen. Und dann noch Hausnummern, Mitgliedsnummern und Lottozahlen. Oder auch Flug-Nummern, Nummern von Bibliotheksausweisen und Schecknummern.
Man könnte den Eindruck gewinnen, das eigene Leben und die persönliche Identität seien zu einer endlosen Auflistung von Zahlen und Nummern, unterbrochen von gelegentlichen Bindestrichen, „entpersonalisiert“ worden.
Doch es ist nicht so: Ihr Leben hat einen Sinn und Zweck.
„Wer bin ich?“, fragte der einst als Galeerensträfling verurteilte barmherzige Samariter Jean Valjean in Les Misérables, dem Victor Hugos Roman nachempfundenen Musical. „2-4-6-0-1“, gab sein Rächer, der hartherzige Gefängnisaufseher Javez, höhnisch zur Antwort. Für ihn war Valjean eben nichts als eine Nummer, ein Leben ohne Wert, ein Mann, dessen Vergehen eine erneute Verhaftung und Bestrafung nur rechtfertigte. Doch für andere war Valjean der Retter aus der Not, ein Wohltäter, Freund und Beschützer. Die Nummer 24601 war alles andere als eine Erkennungsmarke für den Menschen Jean Valjean. Und genauso wenig sind all die Zahlen und Nummern, mit denen wir heute zu tun haben, dazu angetan, wirklich etwas über uns auszusagen – oder darüber, wozu wir bestimmt sind.
Eine Belegschaftsnummer oder Adresse ist bezüglich der Frage, wer wir sind, um nichts aussagekräftiger als die Eintragungen auf unserem Bankkonto oder unsere Besitztümer.
Zahlen und Nummern sind praktisch und nützlich und erfüllen einen Zweck. Sollten Sie Mathematiker sein, mögen sie Ihnen vielleicht sogar schön vorkommen! Aber sie sagen nichts darüber aus, wer wir sind, was uns gefällt, wovon wir träumen, wovor wir Angst haben, warum wir leben, wie wir leben oder wofür wir leben. Weil wir eben nicht unpersönliche Statistiken in irgendeinem seelenlosen Universalsystem darstellen. „Kauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater“, hat Jesus gesagt. „Darum fürchtet euch nicht; ihr seid besser als viele Sperlinge“ (Matth. 10, 29-31).
„Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt“ – Matth. 10,30 –.
Gott nimmt tiefen, persönlichen Anteil an einem jeden von uns. Er kennt uns – ein Gedanke, der gemischte Gefühle hervorrufen kann. Denn die Bibel sagt uns, dass Gott uns in- und aus- wendig kennt: Er kennt sogar unsere Gedanken. „Er kennt ja unsres Herzens Grund“, schrieb der Psalmist (Ps 44,22). „Der Herr kennt die Gedanken der Menschen“ (Ps 94,11). Das kann Besorgnis auslösen, vermittelt zugleich aber auch große Sicherheit und Geborgenheit. Denn das heißt doch, dass Gott weiß und versteht, wie wir mit dem Leben kämpfen. Er kennt unseren Kampf um Sinn und Zweck und um unseren Platz in der Welt. Er kennt unsere innersten Träume und Ängste. Er kennt und versteht, dass wir um unseren Glauben an ihn kämpfen. Er kennt unsere guten Absichten. Und er kennt unsere Scheinheiligkeit. Er kennt die Wunden, die wir tragen, und er kennt die Wunden, die wir anderen zugefügt haben. Er weiß, dass wir mehr sind als ein Zahleneintrag in irgendeiner Datenbank.
Und ein jeder von uns hat seinen Platz in Gottes Schöpfung und im göttlichen Plan: „Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen“, schrieb der Apostel Paulus (Eph. 2,10).
Um uns diesem Sinn und Zweck widmen zu können, müssen wir natürlich andere Dinge aufgeben, die uns – und anderen – sehr wichtig erscheinen mögen, zumal in unserem Leben keine höhere Autorität gegenwärtig ist. Und doch ist es so, dass die Weisheit, die uns die früheren Generationen und Zeitalter übermittelt haben, eine Warnung an uns enthält: All solches Streben und Verlangen sei bestenfalls von vorübergehender Bedeutung und schlimmstenfalls töricht. „Keiner wird auf dem Totenbett behaupten, er wünschte, mehr Zeit im Büro verbracht zu haben“, geht eine moderne Redensart. Und vor mehr als 2000 Jahren schrieb ein weiser König ein Buch über seine vergeblichen Mühen: „Da war es alles eitel und Haschen nach Wind“ (Pred. 2,11). Das kann schon entmutigen! Und doch werden allzu viele Leben dem „Haschen nach Wind“ geopfert.
Jesus hat den Konflikt zwischen den Ansprüchen und Verlockungen der physischen Erfahrung und den höheren realen Ansprüchen des Geistes angesprochen: „Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme an seiner Seele Schaden? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse?“ (Mark. 8,36-37). Genau dies aber sind wir versucht zu tun: die Welt zu gewinnen und Schaden an unserer Seele zu nehmen. Nach dem Wind zu haschen. Darum hat Paulus die Menschen so eindringlich gewarnt, nicht länger ihren alten Lebenswandel fortzusetzen, sondern sich Gott und seinem göttlichen Plan zu überlassen (Röm. 6,13).
„Du hast uns zu dir hin geschaffen, und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir.“ – Augustinus von Hippo –.
Das klingt alles gut und schön, mutet aber auch ein wenig unerreichbar an. Wir kennen doch unsere Schwächen und unser Versagen. Wir wissen doch, dass wir all unseren Bemühungen zum Trotz kein vollkommenes Leben führen – nicht einmal ein Leben, das „gut genug“ wäre. Nicht für einen vollkommenen Gott. Das entmutigt.
Stellen Sie sich daher vor, wie es auf die Jünger gewirkt haben muss, als Jesus ihnen verkündete, er werde sie nun verlassen und zum Vater im Himmel zurückkehren, aber er werde wiederkommen. Obwohl er ihnen versicherte, er werde wiederkommen, reagierten sie verunsichert. Und deshalb gab er ihnen die Gewissheit, seine geistige Gegenwart solle ihnen auf alle Zeit erhalten bleiben: „Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen andern Tröster [oder „Fürsprecher“, „Beistand“] geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit: den Geist der Wahrheit ...“ (Joh. 14,16-17). Es ist der Heilige Geist.
In der griechischen Sprache, in der dieser Text ursprünglich verfasst wurde, bezieht sich das für „Tröster“ oder „Beistand“ verwendete Wort auf jemanden, der einem anderen zur Seite tritt, um ihm zu helfen und Mut zu machen. Und deshalb gereicht es auch uns zu großer Ermutigung, die wir bestrebt sind, im Leben einen Sinn zu erkennen und uns der herausfordernden Frage zu stellen, welche Ziele wir verfolgen wollen. Die Aufforderung, für Gott und seinen göttlichen Plan zu leben, lässt uns in unserem Kampf nicht allein: Gott gibt uns die Gewissheit, dass er immer für uns da sein wird.
Das ist leicht gesagt. Aber auch schwer zu glauben. Es könnte sogar eine misstrauische oder zynische Reaktion auslösen: „Na und?“ Weil Gott in so weiter Ferne zu sein scheint. Und die Vorstellung, ein Gott „in weiter Ferne“ sehe einen bestimmten Sinn und Zweck für einen jeden von uns vor, kann in Anbetracht all der Anforderungen und Zwänge, denen wir Tag für Tag ausgesetzt sind, schon etwas „abgehoben“ anmuten.
Und doch ist es so, dass wir täglich mit einer geistigen Dimension leben – sie sogar für selbstverständlich halten. Wir suchen in der Arbeit, die wir tun, eine „Bedeutung“. Wir streben nach „Ganzheitlichkeit“ in unserem Leben. Wir sind uns nicht nur unseres Lebens und unseres Menschseins bewusst, sondern beobachten unsere Erfahrungen und unterziehen sie einer ständigen Bewertung. Wir gestalten unsere Beziehungen zur Welt, zu anderen Menschen und zu uns selbst nicht nur mittels der externen Erfahrungswelt, sondern auch kraft unserer inneren Welt der Gedanken, Wertvorstellungen und Sinngehalte. Vielleicht beten wir. Vielleicht glauben wir an Gott oder an eine höhere Macht in unserem Universum. Vielleicht ist es auch so, dass wir erst dann zu beten beginnen oder an Gott denken, wenn wir selbst oder uns nahestehende Menschen in eine lebensbedrohliche Situation geraten. Dann nämlich geschieht es fast von selbst, dass wir Gott anrufen.
Diese täglichen Realitäten zählen zu den geistigen Aspekten unseres Lebens. Und sie sind um nichts weniger real – häufig sogar weitaus mächtiger – als die physischen Realitäten, mit denen wir jeden Tag befasst sind. So ist einmal gesagt worden, wir seien nicht physische Geschöpfe, die nach geistiger Erfahrung suchen, sondern geistige Geschöpfe mit physischer Erfahrung. Managementbücher und Führungsseminare betonen zunehmend die Tatsache, dass wir Menschen in uns ein wesentliches und unvermeidliches Bedürfnis verspüren: Wir verlangen nach Befriedigung und Verständnis unserer geistigen Bedürfnisse. Wir verspüren in uns den Drang, Sinn und Bedeutung zu finden, Bedeutsames zu bewirken, Besonderes zu leisten. Und das hat Gott uns zu bieten: Er weist uns einen Weg, genau dieses Verlangen in Einklang mit ihm zu erfüllen.
„Wir arbeiten mit Methoden, die zu klein sind für unseren Geist“, sagt der amerikanische Autor Studs Terkel. Wie schnell ist Leben vertan mit sinnentleerten „Tändeleien“! Andererseits kann Leben sinnvoll, bedeutungsvoll, wirkungsvoll gelebt werden im Licht der Liebe, Führung und zweckvollen Planung Gottes. Wir stehen vor der Wahl. Tagtäglich entscheiden wir, wofür wir ein Stück unseres Lebens einsetzen wollen. So oder so – für irgendetwas geben wir immer ein Stück unseres Lebens.
Unsere moderne Gesellschaft belohnt Freiheit und Individualität. Wir nehmen für uns das Recht in Anspruch, selbst zu entscheiden, was wir tun und wie wir leben wollen. In einem gewissen Sinn ist dies ein gottgegebenes Recht. Aber es bedeutet noch lange nicht, dass wir auch die richtige Wahl treffen. Oder dass die von uns getroffene Wahl schon deshalb gut wäre, weil wir von unserer Entscheidungsfähigkeit Gebrauch machen.
Wenn wir die richtige Richtung einschlagen wollen, brauchen wir einen Kompass. Wenn wir zuversichtlich zu unserer Wahl stehen wollen, brauchen wir ein Fundament.
„Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme an seiner Seele Schaden? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse?“
– Markus 8,36-37 –
In den bisherigen Folgen unseres Bibelstudiums haben wir uns mit den Grundlagen – den Stützen – des christlichen Glaubens befasst. Wir haben das Argument vertreten, dass unser Leben Bedeutung, Sinn, Wert und eine geistige Dimension besitzt, die wir nicht vernachlässigen dürfen. Und wir haben das Wesentliche des christlichen Glaubens dargelegt – auf der Grundlage des Evangeliums, der „guten Nachricht“ von all dem, was Gott in unserer Welt durch Jesus von Nazareth, Jesus Christus, den Messias, unseren Erlöser, bewirkt hat.
Im Folgenden wollen wir die bisher genannten Grundlagen noch einmal zusammenfassen.
Begonnen haben wir mit der Frage: „Warum dem Christentum Glauben schenken?“ In einer Welt, in der wir häufig hören, „im Grunde genommen sind alle Religionen gleich“ oder „eigentlich spielt es keine Rolle, was Sie glauben, solange Ihnen dieser Glaube weiterhilft“, gelten für Christen ganz besondere und gezielte Feststellungen, die uns zum Nachdenken und zur kritischen Auseinandersetzung auffordern. Das Christentum ist somit eine „Glaubensangelegenheit“.
So heißt es im Apostolischen Glaubensbekenntnis: „Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige [allgemeine] christliche Kirche, Gemeinschaft [Austausch, gegenseitige Anteilnahme] der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben.“
Doch dieser Glaube ist weder blind noch unbegründet. Wir verfügen nicht nur über die Aufzeichnungen der Heiligen Schrift, der christlichen Bibel (mit dieser Informationsquelle hat sich eine der späteren Folgen unseres Bibelstudiums eingehend befasst) – ,es liegen uns auch physische, moralische, emotionale und spirituelle Beweise für die Gegenwart Gottes vor. Hinzu kommen der historische Jesus-Beweis und die Schilderung des gottesfürchtigen Lebens christlicher Männer und Frauen über mehr als 2000 Jahre hinweg.
- Er hat die Welt erschaffen, ist mit den Menschen in Interaktion getreten und hat Prophezeiungen offenbart.
- Er ist zu uns gekommen in der leiblichen Person des Jesus von Nazareth.
- Er ist in den Menschen, die an ihn glauben, durch den Heiligen Geist gegenwärtig.
- Er hat die Gründe für Leid, Schmerzen und Ungerechtigkeit genannt, die sich wie ein roter Faden durch die ganze Menschheitsgeschichte ziehen.
- Er hat seinen Plan für die Menschheit und seine persönliche Fürsorge und Anteilnahme an unserer Welt und unserem Leben offenbart.
- Er erfüllt unser Leben mit Sinn und schenkt uns Hoffnung über den Tod hinaus.
Weiterhin haben wir festgestellt, dass insbesondere in unserer zeitgenössischen westlichen Gesellschaft ein erheblicher Energieaufwand getrieben wird, um die Existenz Gottes, wie sie in drei der fünf großen Weltreligionen (Christentum, Judentum und Islam) anerkannt wird, zu widerlegen.
Entsprechend haben wir uns mit Gründen befasst, aus denen Leute meinen, nicht an Gott glauben zu können:
- „Die Existenz Gottes lässt sich nicht beweisen.“
- „Der Glaube an Gott ist nur eine emotionale Krücke.“
- „Es gibt so viel Böses und so viel Leid in der Welt, dass es keinen Gott geben kann.“
- „Die Naturwissenschaft hat die Existenz Gottes widerlegt.“
In unseren Ausführungen zu diesen Einwänden haben wir die Gegenfrage gestellt: Selbst wenn sinnvoll argumentiert werden könnte, eine so komplexe Welt wie die unsrige sei zufällig, ohne Zweck und Plan, entstanden – wie ließen sich denn im Weiteren das Denkvermögen des Menschen, seine Vernunft, Argumentationsfähigkeit, Logik, Emotionalität und seine einmalige, individuelle Persönlichkeitsausprägung erklären? Und wie steht es mit „Gut“ und „Böse“? Mit Moral und Gewissen?
Ferner haben wir festgehalten, dass der Mensch über alle Zeiten und Kulturen hinweg nach einem Verständnis der eigenen Existenz in einem größeren, geistigen Kontext strebt. Selbst unter jahrzehntelanger atheistischer Herrschaft ist Glaube bekundet worden. Des Weiteren haben wir uns mit den Unterschieden zwischen den Weltreligionen befasst: Christentum, Judentum und Islam verehren einen Gott („Monotheismus“), doch während sich das Judentum auf die Lehren des Mose (ca. 1400 v. Chr.) und die alttestamentlichen Propheten der Bibel beruft und der Islam auf den Propheten Mohammed (ca. 570 – 632 n. Chr.) und den Koran (Qur’an) zurückgeht, basiert das Christentum auf Jesus Christus als dem zuvor prophezeiten, im Evangelium offenbarten und durch neutestamentliche Kirchenschriften bezeugten Messias. Demgegenüber sind die östlichen Religionen wie Buddhismus, Hinduismus und Taoismus „monistische“ Religionslehren: Sie vertreten die Auffassung, dass „alles von grundsätzlich derselben Art ist“. [1]
Einige dieser Religionen lehren einen „Weg“ oder einen „Pfad“, verkünden aber keinen Gott – im Gegensatz zu anderen, die gleich zahlreiche Götter nennen.
Der Glaube an Gott wird durch offenkundige Fakten fundiert:
- Die Welt, in der wir leben
- Gestaltung der Welt
- Menschliche Vernunft und Kreativität
- Persönlichkeit
- Werte
- Gewissen
- Religion [2]
Jedes einzelne Faktum macht mehr Sinn, wenn Gott existiert. Insgesamt betrachtet wird die Existenz Gottes umso überzeugender. Wenn wir dazu noch die durchweg stimmige und lebensnahe Botschaft der Bibel betrachten, sehen wir uns mit der folgenden Frage konfrontiert: Glauben wir, dass Zufall, Zeit und eine Theorie über die Entwicklung unserer natürlichen Welt diese Realitäten „irgendwie“ zusammengefügt oder geschaffen haben? Oder aber – dass die Welt, die wir um uns erkennen (und in uns erfahren), einen Schöpfergott nahelegt, der einen Zweck und Plan für seine Schöpfung verfolgt?
Der Glaube an Gott wird durch offenkundige Fakten fundiert.
„Ich bin das Licht der Welt.“ – Joh. 8,12 –
„Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.“ – Joh. 14,6 –
In Anerkennung des Anspruchs der Bibel, das inspirierte Wort Gottes zu sein, haben wir die folgenden Argumente angeführt:
- Die Glaubwürdigkeit der Bibel
- Ihre Genauigkeit in der Wiedergabe menschlicher Erfahrungen
- Ihre Einheitlichkeit und Kohärenz über mehr als 1500 Jahre – bei mehr als 40 Verfassern in drei Sprachen
- Ehrliche Darstellung der Auserwählten Gottes als unvollkommene Menschen
- Die Qualität ihrer moralisch-ethischen Lehre
- Augenzeugenberichte
- Reichliche Beweise durch Handschriften (vom griechischen Neuen Testament gibt es mehr Manuskripte als von jedem anderen vergleichbaren historischen Dokument)
- Im Lauf der Geschichte erfüllte Weissagungen
- Auswirkungen auf die Menschheitsgeschichte und das Leben einzelner Menschen.
Die Botschaft der Bibel lautet: Gott hat uns zu einem bestimmten Zweck erschaffen, doch die Menschen haben ihn und seinen Zweck eigenmächtig zurückgewiesen; wir sind dafür verdammt und von der göttlichen Macht abgeschnitten worden, aber in seiner Barmherzigkeit hat uns Gott einen Weg zur Vergebung und Versöhnung mit ihm gezeigt. Dieser Weg ist Jesus Christus, menschgewordener Gott, Immanuel – Gott mit uns. Dies ist „das Evangelium“ – die „gute Nachricht“ von dem, was Gott für uns in Jesus Christus getan hat.
Die Bibel vermittelt die Botschaft Gottes an uns. Sie offenbart ihn als einen sich „mitteilenden“ Gott – nicht als ein in weite Ferne entrücktes, abgeschiedenes oder unpersönliches Wesen, sondern als einen Gott, der gewillt ist, in unserer Welt und unserer alltäglichen Erfahrung in Erscheinung zu treten. Die Bibel berichtet, dass Gott unsere Welt erschaffen hat. Sie berichtet von seiner Interaktion mit dem Volk Israel. Sie berichtet seine Worte durch die Propheten. Und sie berichtet von seinem „Erlösungswerk“ und seinem Willen, uns ein Leben über den Tod hinaus zu ermöglichen. Durch die Auferstehung Jesu Christi wird uns eine Hoffnung zugesichert, die das Grab überwindet.
Durch Jesu Gegenwart auf Erden sind unsere Sünden getilgt – unsere Zukunft ist gewährleistet. Dies ist die Botschaft, die unermüdlich von der frühchristlichen Kirche verbreitet wurde. In Jesus Christus hat Gott die Hoffnung für die Menschheit offenbart. Nicht, weil wir etwas dazu beigetragen hätten, sondern allein aus seiner Großmut, seiner Liebe, seiner „Gnade“ heraus. Die Bibel beginnt mit den Worten: „Am Anfang schuf Gott ...“ und endet mit: „Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Amen.“
Die Berichte der Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes offenbaren uns den Begründer des Christentums: Jesus Christus. Jesus selbst bezeichnete sich als „das Brot des Lebens ... die Tür ... den guten Hirten ... die Auferstehung und das Leben ... den Weg und die Wahrheit und das Leben ... den wahren Weinstock“. Und wer ihm nachfolgte – Menschen, die zu seiner Zeit lebten oder nach seinem Tod von ihm gehört hatten – , war sich dessen bewusst, dass Jesus nicht nur Mensch war. „Mein Herr und mein Gott“, rief der „ungläubige“ Thomas aus. „Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn“, bekannte der Jünger Simon Petrus.
Jesus war ein Mann der Wunder, Gott mit uns, und ein Freund aller Menschen, auch von Außenseitern und von gesellschaftlich geächteten Menschen. Jesus war gekommen, damit wir Gott erkennen und erfahren, wer er ist und wie er wirklich ist – auf gänzlich unerwartete Weise. Gott ist nicht „irgendwo da oben“; er ist jedem Einzelnen von uns nah. Er kennt uns, er liebt uns und er will von uns erkannt werden, damit wir an ihn glauben.
Deshalb hat er sich zu unserem Erlöser gemacht: „Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren“ (Röm. 5,8).
Denn unsere Welt ist „zerbrochen“. Gottes vollkommene Schöpfung ist verletzt. Einer der Christen aus der Frühzeit hat den Ausdruck „gefallen“ verwendet, um den Zustand unserer Welt zu beschreiben. Die Bibel spricht in diesem Zusammenhang sowohl auf individueller als auch auf gemeinschaftlicher Ebene von „Sünde“. Jesu Leiden und Tod am Kreuz sollen uns in alle Ewigkeit an zwei Dinge erinnern, die für die menschliche Erfahrung von allerhöchster und unergründlicher Bedeutung sind:
- Gott nimmt die Problematik der Sünde ernst – und persönlich.
- Gottes Liebe zu uns übertrifft unsere Vorstellung.
Deshalb dürfen wir auf den Sieg über die Zerbrochenheit, das Gefallen-Sein unserer Welt hoffen. Wir brauchen Sünde, Leid und nicht einmal mehr den Tod zu fürchten. „Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden“, schrieb der Apostel Paulus. „Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unsern Herrn Jesus Christus!“ (1. Kor. 15,21-22.57). Die Botschaft von Jesu Auferstehung von den Toten steht im Mittelpunkt des Evangeliums. Das Kreuz mag ihn getötet haben, aber das Grab konnte ihn nicht halten. Und in dieser Wahrheit liegt unsere ewig währende Hoffnung begründet: „Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden“ (Kol. 1,13-14).
Diese Botschaft – die gute Nachricht – stellt unser Leben in einen Zusammenhang, der sonst nicht gegeben wäre. Das Evangelium bietet uns die Gewissheit neuen Lebens:
„Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben.“ – 1. Kor. 2,9 –
Das Christentum ist eine von Hoffnung erfüllte Religion. „Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker unsrer Seele“ (Hebr. 6,19). In Christus können wir neues Leben erlangen, sowohl heute als auch in der Zukunft, die Gott über die Auferstehung hinaus für uns bereithält. Jesu Predigeramt umfasst zahlreiche Berichte über Hoffnung, Umwandlung, Erlösung – Gnade. Jesus spricht häufig von „Verlorenem“, das letztlich gefunden wird, um zu erläutern, was Gott in unserer Welt bewirkt. Er selbst hat uns gelehrt, was als „Reich Gottes“ bezeichnet
wird.
Das erste Kommen Jesu brachte das Reich Gottes auf die Erde. Mit seiner Geburt, seinen Wundern, seinen Lehren, seinem Tod und seiner Auferstehung hat er unwiderruflich die Gegenwart, Macht und Liebe Gottes bewiesen.
Das Reich Gottes lebt und wächst im Leben aller Menschen, die ihr Leben Gott anvertrauen. Wenn Christen vergeben worden ist und sie wieder mit Gott versöhnt sind, werden sie zu Werkzeugen, durch die Gott sein Reich in die Welt bringt – wir sollen etwas „bewirken“ und seine Liebe weitertragen.
Das Reich Gottes wird seine volle Verwirklichung mit Jesu Wiederkehr erfahren. Die volle Verwirklichung und höchste Erfüllung des Reiches – ohne Einschränkung durch die Begrenztheit unserer zerbrochenen Welt und unserer menschlichen Schwächen – ist eine Verheißung, die Gott für eine zukünftige Zeit vorsieht. Die Bibel vermittelt eine herrliche Vision von einer Welt, die in Frieden mit Gott lebt: „Und [Gott] wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu!“ (Offenb. 21,3-5).
Statt nur in unserer eigenen Welt leben zu wollen, sollten wir bereit sein, uns für Gottes Welt zu entscheiden.
Der christliche Glaube ist voll Hoffnung, lebensnah und gewiss – gründet er doch auf der Wahrheit der Selbstoffenbarung Gottes in Jesus Christus, auf seinem Sieg über die Macht des Bösen und auf der Überwindung der Macht der Sünde. Gott ermöglicht uns, ein neues Leben zu führen und ewiges Leben mit ihm zu ererben. Darum ist unsere Erlösung durch ihn der Anker für unsere Seele.
Diese Hoffnung, dieses neue Leben, dieser Zweck, diese Bedeutung – dies alles ist ein Aufruf an uns: Wir sind aufgerufen, in der großartigsten Geschichte aller Zeiten eine Rolle zu übernehmen. Wir sind aufgerufen, Bedeutung und Zweck herauszufinden, wie wir sie nach Gottes Willen erfahren sollen. Derselbe Aufruf erging an die Jünger, die einstigen Fischer am Galiläischen Meer, als Jesus zu ihnen sprach: „Folgt mir nach.“
Wir müssen uns entscheiden ...
Denken Sie noch einmal über die Fragen nach, mit denen wir unser Bibelstudium, Folge 1, begonnen haben:
Wenn Sie dazu tendieren, der christlichen Botschaft zu glauben – was veranlasst Sie dazu?
Was zieht Sie an, was überzeugt Sie, was lässt Sie glauben, dass die Botschaft wahr ist?
Wenn Sie dazu tendieren, die christliche Botschaft abzulehnen – warum neigen Sie zu dieser Einstellung? Was stößt Sie ab, was lässt Sie zögern, was legt Ihnen nahe, die Botschaft sei nicht wahr?
Wenn Sie bezüglich der Wahrhaftigkeit oder anderer Aspekte der christlichen Botschaft eine neutrale Haltung einnehmen – was hat Sie dazu geführt?
Überlegen Sie nun, inwieweit die Lektüre der bisherigen Folgen unseres Bibelstudiums Ihre Haltung möglicherweise verändert hat. Erkennen Sie, warum dies so sein könnte – oder auch nicht? Denken Sie über einige besondere Aspekte nach, die Ihnen bei der Lektüre neu waren, Ihnen eine Herausforderung bedeuteten, eine Reaktion abverlangten oder aber Unbehagen bereiteten.
Wenn Sie die Berichte der vier Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes gelesen haben, sollten Sie den Bericht, der Ihnen am besten gefallen hat, nun noch einmal lesen. Sofern Sie noch nicht alle Evangelien gelesen haben, sollten Sie sich dem Bericht zuwenden, der Ihnen bei Ihrer Lektüre noch fehlt. Abschließend sollten Sie das Gelesene mit eigenen Worten zusammenfassen.
„Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt; nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende.“ – Pred. 3,11 – ❏
Dieses Bibelstudium erschien zuerst unter dem Titel Foundations of Faith als Beilage von Living Today, der australischen Zeitschrift der GCI.
[2] Green, M., My God (Eagle, 1991), S. 8.
© Stiftung WKG in Deutschland

