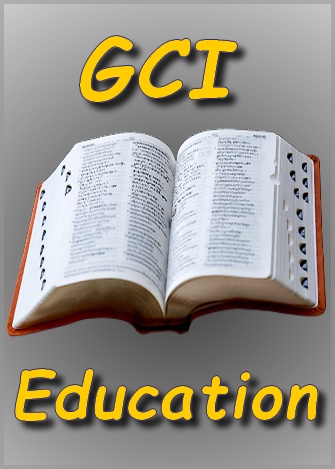
14. Beten und Gebet. Freileitung – Leitung für das Leben
Drei Geistliche waren in eine Diskussion vertieft, derweil ein Fernmeldetechniker an einem defekten Telefon im Büro arbeitete. Gesprächsthema war der richtige Ansatz zum Gebet. Einer der Geistlichen sagte, beim Beten käme es seiner Ansicht nach entscheidend darauf an, dass die Hände in die korrekte Position gebracht würden. „Die Hände sollten immer zusammengehalten werden, wobei die Finger gen Himmel zeigen“, sagte er. Ein anderer meinte, das Wichtigste sei, dass der Betende niederkniet, um seine Demut zu bezeugen. Der dritte Geistliche wollte von all dem nichts wissen – für ihn konnte der Betende seine Ergebenheit vor Gott nur dadurch zum Ausdruck bringen, indem er liegend den Boden mit der Stirn berührt.
Der Fernmeldetechniker hatte dem Gespräch zugehört und konnte nicht umhin, seine eigene Meinung beizusteuern. „Ich bin kein Heiliger“, sagte er, „aber als ich einmal hoch oben auf einem Telefonmast das Gleichgewicht verloren hatte und kopfüber 20 Meter über einer befahrenen Fernstraße hing, da, möchte ich meinen, habe ich wohl das beste Gebet aller Zeiten gebetet!“
„Die beste und würdigste Haltung der Männer und Frauen ist die, im Gebet vor Gott das Knie zu beugen“, sagt der bekannte christliche Autor John Stott. „Beten bedeutet, dass wir nach dem Bilde Gottes geschaffen sind. Denn wir sind Menschen, von Gott und für Gott geschaffen, da wir Gemeinschaft mit Gott haben. Beten ist daher eine authentische Aktivität als solche, unabhängig von irgendwelchen Vorteilen, die uns das Gebet bringen könnte. Und doch ist das Gebet auch eines der effektivsten aller Gnadenmittel. Wohl kaum hat es je einen christusähnlichen Menschen gegeben, der sich nicht um das Gebet bemüht hat.“ [1]
„Gott hat uns erschaffen und zur Gemeinschaft mit ihm erlöst; das ist es, was ein Gebet ausmacht“, sagt J. I. Packer. „Gott spricht zu uns in der Bibel und durch ihren Inhalt, den uns der Heilige Geist erschließt und in seiner Anwendung auf uns verständlich macht. Dann ist es an uns, mit Gott über ihn und uns und die Menschen in seiner Welt zu sprechen: Unsere Worte sind Antwort auf das, was er gesagt hat. Diese einzigartige Form des Zwiegesprächs währt ein Leben lang.“ [2]
Wie die fiktive Geschichte vom Fernmeldetechniker verdeutlicht, kann ein Gebet manchmal auch eine instinktive Reaktion sein – ein aus tiefstem Herzen kommender, aus dringlichem Anlass motivierter Hilferuf nach Gott, selbst wenn das Gebet sonst keinen festen Platz in unserem Leben hat. Andererseits kann ein Gebet auch zu einer verwirrenden und sogar entmutigenden Herausforderung geraten. Manchen Leuten fällt das Beten leicht. Anderen fällt es schwer. Und wiederum gibt es Leute, die das Beten noch gar nicht für sich entdeckt haben.
In dieser Folge wollen wir uns den Fragen zuwenden,
• was Beten bedeutet,
• wie Jesus seine Jünger zu beten gelehrt hat und
• welche Arten von Gebet es gibt.
„Die Bibel lehrt uns anhand von Beispielen, dass Beten eine vierfache Aktivität ist“, so Packer, „die Gottes Volk, ein jeder für sich allein (Matth. 6,5-8) und in Gemeinschaft miteinander (Apg. 1,14; 4,24), ausüben soll. Es gilt, Verehrung und Lob zum Ausdruck zu bringen; Sünden reumütig zu bekennen und um Vergebung zu bitten; für empfangene Wohltaten Dank zu sagen; und Bitten und Fürbitten für uns und andere in Worte zu fassen.“ [3]
„Wirkliches Beten ist lebensschaffend und lebensverändernd“, schreibt Richard Foster. „Beten bedeutet Veränderung. Das Gebet ist der zentrale Weg, den Gott gewählt hat, um uns zu verändern.“ [4]
Beten verändert uns dahingehend, dass wir Gott – zu dessen Ebenbild wir erschaffen wurden – ähnlicher werden. Im Gebet können wir mit Gott sprechen und ihm danken, ihn loben, ihn um Hilfe bitten und ihm unsere Liebe und Fürsorge für andere zum Ausdruck bringen.
Die meisten Menschen in der westlichen Welt haben irgendwann einmal das „Vaterunser“ (siehe Kasten) gehört. Das Vaterunser ist die überlieferte Antwort Jesu auf die Bitte der Jünger, sie beten zu lehren. Es steht in Matthäus 6,9-13 und in Lukas 11,2-4. Das Gebet des Herrn besteht aus mehreren Teilen.
Das „Vaterunser“ steht in Matthäus (als Teil der Bergpredigt) und in Lukas im Zusammenhang mit der Bitte der Jünger an Jesus, er möge sie das Beten lehren. Deshalb dient uns das Vaterunser als wichtiger Leitfaden für unsere Gebete.
Dein Name werde geheiligt.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Diese Worte richten den Betenden auf Gott aus. Es ist Gott, den wir sprechen möchten: Das Gebet ist eine freie Leitung, die uns mit Gott persönlich verbindet. Das ist ein überwältigender Gedanke: dass wir als endliche, schwache Menschen mit dem Einen kommunizieren können, der uns und alles, was wir um uns herum erblicken und erkennen, erschaffen hat. Aber mehr noch: Durch Ausrichten des Betenden auf Gott stellt das Gebet auch eine vertraute Beziehung her. Wir sollen Gott als „Vater“ ansprechen. Jesus lenkt unser Denken – im Gebet – auf eine Vater-Kind-Beziehung. Natürlich hat er dies in positivem Sinn verstanden.
Leider haben viele Menschen negative Eltern-Kind-Beziehungen erfahren, die dieses fundamentale Prinzip des Betens erschwert. Dennoch ist dies eine machtvolle Wahrheit: Wir sind Gottes Kinder, die er wertschätzt und für die er sich persönlich und leidenschaftlich einsetzt. Die Bibel weist wiederholt auf diese Beziehung hin.
„Abba“ ist ein aramäisches Wort, das im vertrauten, warmen und familiären häuslichen Rahmen benutzt wurde. Es ist die liebevolle Anrede eines Kindes gegenüber seinem Vater. Vergleichbar, wenn auch etwas vereinfacht, ist das englische „Dad“ oder „Papa“ im Deutschen.
In seiner Gebetsanleitung erinnert uns Jesus daran, dass wir uns beim Beten an einen liebenden, Anteil nehmenden, mitleidenden, verständnisvollen und unterstützenden Vater wenden.
Eine gesunde Eltern-Kind-Beziehung ist natürlich keine Einbahnstraße. Zu einer vertrauensvollen Beziehung gehört auch Respekt. Und Jesus erinnert uns daran, wenn er sagt, beim Beten sollten wir sowohl unsere persönliche Hochachtung vor Gottes Namen – seinem Ansehen, seiner Identität, seiner Autorität, seiner Natur – als auch den Wunsch, dass auch andere diesen Namen kennen lernen, zum Ausdruck bringen.
„In der modernen Welt dient der Name einer Person lediglich als Etikett zur persönlichen Identifizierung ... Demgegenüber haben biblische Namen ihren Hintergrund in der weit reichenden Tradition, dass Personennamen Informationen vermitteln und die Namensträger in irgendeiner Weise kennzeichnen. Das Alte Testament weist an vielen Stellen darauf hin, wie herrlich Gott seinen Namen Israelbekannt gemacht hat, und in den Psalmen wird Gottes Name immer wieder gelobt (Ps. 8,2; 113,1-3; 145,1-2; 148,5.13). ‚Name‘ bedeutet hier, dass sich Gott durch Wort und Tat offenbart hat.“ [5]
Jesus sagt, wir sollten im Gebet unser Verlangen nach dem Reich Gottes zum Ausdruck bringen (nach seiner Herrschaft in unserer Welt und in unserem Leben, jetzt und letztendlich in zukünftiger Erfüllung). Diese Anleitung unterstreicht ein zentrales Thema im Wirken und Lehren Jesu: das Reich Gottes als Ausdruck des Verlangens, die Menschheit möge das Reich – Gottes Gegenwart, Herrschaft und Autorität – kennen lernen und erfahren. Dieses Verlangen steht im Zusammenhang mit der nächsten Bitte (dass Gottes Wille geschehe „wie im Himmel so auf Erden“), verweist aber auch auf das Streben nach der zukünftigen Erfüllung der Gotterfahrung.
„Die dritte Bitte ist eigentlich eine Erweiterung der zweiten: Wo Gottes Herrschaft Anerkennung findet, geschieht Gottes Wille. Dahinter verbirgt sich somit das Eingeständnis, dass Gottes Wille auf Erden eben nicht getan wird und dass es immer ein Spannungsverhältnis zwischen dem göttlichen Willen und der Realität menschlicher Strukturen und Beziehungen geben wird, bis das Reich Gottes herbeigekommen ist.“ [6]
Eine der größten Versuchungen beim Beten kann die Bitte sein, „unser Wille geschehe“. Wir haben aber die klare Anleitung bekommen, dass wir im Gebet Gottes Willen für unser Leben suchen sollen. Beim Beten geht es nicht darum, Gott von unserer Sichtweise des Geschehens zu überzeugen, sondern seine göttliche Perspektive zu erfahren. Der bekannte christliche Autor C. S. Lewis hat einmal dieses Gebet verfasst: „Dein Wille geschehe, durch mich, jetzt!“
In seiner Anfechtung vor der Kreuzigung fasste Jesus seinen Gehorsam vor dem Willen des Vaters in eindrucksvolle Worte:
Hier verlagert sich der Schwerpunkt des Gebets von der Verehrung Gottes und der Unterwerfung unter seinen Willen auf das Reich der Menschen. Wir werden daran erinnert, wie wichtig es ist, unsere Prioritäten richtig zu setzen:
„Beim Übergang von der ersten Hälfte des Gebets zur zweiten sind zwei wichtige Aspekte hervorzuheben.
1. Bemerkenswert ist, dass die ersten zwei/drei Bitten des Gebets Gott, seinen Namen, seine königliche Herrschaft (und seinen Willen) betreffen. Erst in der zweiten Hälfte bezieht sich das Gebet auf menschliche Bedürfnisse. Die Priorität ist eindeutig ...
2. Es erfolgt der Übergang von der zweiten Person Singular (,Dein Name‘, ,Dein Reich‘, ,Dein Wille‘) zur ersten Person Plural (,Unser Brot‘, ,unsere Schuld‘, ,wir‘) ... Der Betende spricht sein Gebet als Mitglied und im Namen der Gemeinschaft aller, die Gottes Hilfe bedürfen. Der Einzelne empfängt nur, was allen zuteilwird.“ [7]
Diese Bitte bringt zum Ausdruck, dass unser Leben und die Erhaltung unseres Lebens von Gott abhängt. Sie ist Ausdruck unseres Vertrauens, enthält aber auch eine Einschränkung: Gib uns das, was wir brauchen, nicht unbedingt das, was wir haben möchten.
Doch dieses „tägliche Brot“ ist weit mehr als nur die Speise, die unseren Leib nährt. Es trägt der Tatsache Rechnung, dass wir sowohl geistliche als auch physische, logische und emotionale Geschöpfe sind. Jesus hat dieses „Brot“ in seinem Wirken auf Erden verkörpert.
Wir können auf Gott vertrauen, dass er sich unserer Bedürfnisse annimmt, und dies ist eine großartige Quelle der Ermutigung – gleich, ob unsere Bedürfnisse nun physischer, geistlicher oder emotionaler Art sind:
Vergebung ist keine natürliche Reaktion. Rache schon. Diese Bitte erinnert uns nicht nur daran, dass wir der Vergebung bedürfen und dass Gott sie gewährt, sondern auch daran, dass uns vergeben wird – auch wenn uns dies unverständlich ist. Was können wir, denen vergeben wurde, denn anderes tun, als auch anderen zu vergeben? Vergebung zeugt auf eindrucksvolle Weise von der Gnade und Gegenwart Gottes in unserem Leben und damit in unserer Welt.
Und wir bedürfen der Vergebung nicht nur einmal: Viele Male straucheln und fallen wir auf unserer Glaubensreise. Wie ermutigend ist es zu wissen, dass wir
Es gehört zur Realität des christlichen Lebens, dass wir unaufhörlich Versuchungen und Anfechtungen ausgesetzt sind. Eines der größten Missverständnisse bezüglich des christlichen Glaubens ist die Auffassung, der Glaube „löse alle unsere Probleme“. Wir werden täglich mit unseren Schwächen und Unzulänglichkeiten konfrontiert. Wir leben in einer gefallenen Welt. Wir müssen physische, emotionale, psychologische und geistliche Herausforderungen ertragen. Wir brauchen Kraft. Wir brauchen Schutz. Wir brauchen Erlösung. Nur Gott kann uns helfen.
Viele von uns haben eine Version des Vaterunsers gelernt, die mit den Worten schließt:
Das Gebet des Herrn ist ein schlichtes, aber eindrucksvolles Vorbild dafür, wie wir beten sollen – ein Gebet, das uns Jesus selbst gegeben hat.
Natürlich gibt es ganz verschiedenartige Gebete. Die wichtigsten Gebetsarten werden nachstehend erläutert.
Je mehr wir Gott kennen lernen, desto mehr haben wir ihm zu danken. Für seine Gnade, die
er uns zuteilwerden lässt, für die Menschen, die in unserem Leben wichtig sind, für das Leben an sich. Wir dürfen nie aufhören, Gott zu danken.
Dem Lob Gottes kommt im Gottesdienst zentrale Bedeutung zu. Lob bedeutet „die Verehrung und Anbetung Gottes zur Feier der Existenz und des Wertes Gottes“. [8] Tatsächlich ist das Wort „Lob“ ursprünglich aus dem lateinischen Wort für „Wert“ abgeleitet.
Das Gebet, das uns Jesus als Vorbild gegeben hat, erinnert uns daran: Wir brauchen täglich Gottes Hilfe. Manchmal sind wir ganz dringend auf Gottes Anteilnahme, Eingreifen oder Ermutigung angewiesen. Gott hört unser verzweifeltes Flehen:
Gebete für andere, die sogenannten Fürbitten, sind nicht nur ein zentraler Bestandteil geistlicher Gemeinschaft (Beten für andere Christen), sondern gehören auch zum Leben als Christ in einer umfassenderen Welt.
Jesus hat uns gelehrt, um Vergebung zu bitten. Voraussetzung für die Bitte um Vergebung ist Reue und Bußfertigkeit – die Bereitschaft, „umzukehren und den anderen Weg einzuschlagen“. Buße ist mehr als lediglich Bedauern oder Gewissensbisse (oder Furcht vor Bestrafung). Buße bedeutet, dass man aus tiefstem Herzen gewillt ist, nicht mehr zu sündigen und vielmehr Wertvorstellungen, Gedanken und Verhaltensweisen anzunehmen, die Gottes Wille bezeugen und zum Ausdruck bringen.
Buße spielte in Jesu Lehre eine Schlüsselrolle:
Es fällt uns nicht leicht, Gott unsere Buße zum Ausdruck zu bringen. Wir wissen, dass wir seiner Ehre und seinem Willen in unserem Leben nicht Genüge tun. Wir haben uns von ihm abgewendet. Und doch lässt uns sein Wort gewiss sein: Er erwartet von uns, dass wir unsere Buße zum Ausdruck bringen und um seine Vergebung bitten – er ist bereit und gewillt, reinen Tisch zu machen.
Beim Beten machen wir vor allem leicht den Fehler, die ganze Zeit selbst zu reden. Und manchmal fallen uns einfach keine Worte ein. Oder sie bringen nicht das zum Ausdruck, was wir sagen wollen. Oder sie drängen sich dazwischen. Wie ermutigend sind da die Worte des Paulus:
Über diese Bibelstelle sollten wir nachdenken. Sie will uns sagen, dass Gott unsere Gebete hört – auch die Gebete, für die wir keine Worte finden. Und da wir wissen, dass Gott uns wirklich genau zuhört, müssen auch wir ihm unsere Aufmerksamkeit schenken – wir müssen lernen, dem zuzuhören, was er uns zu sagen hat, in seinem Wort und als Antwort auf unsere Worte an ihn.
John Stott regt an, dass wir uns beim Beten an die folgenden fünf Perspektiven halten:
Zweitens blicken wir in unser Inneres.
Drittens schauen wir uns um mit Blick auf andere.
Viertens schauen wir zurück auf die Vergangenheit und erkennen, was Gott getan hat.
Fünftens schauen wir in die Zukunft und bringen unsere Hoffnung und unseren Glauben zum Ausdruck.
- Denken Sie der Reihe nach über diese Perspektiven nach: Welchen Ausdruck finden sie in Ihren Gebeten?
- Welche dieser Perspektiven erscheint Ihnen am natürlichsten? Warum?
- Bei welcher Perspektive müssen Sie sich besonders Mühe geben? Warum?
- Können Sie sich erinnern, irgendwann in Ihrem Leben Gottes Wort, seinen Willen oder seine Antworten „gehört“ zu haben? Wie würden Sie solche Erfahrungen beschreiben?
- Wie können Sie Ihre Fähigkeit verbessern, im Gespräch mit Gott zuzuhören?
Wir möchten Ihnen empfehlen, in den Psalmen zu lesen. Nicht alle werden Sie oder Ihr Leben spontan ansprechen, aber ganz sicher gibt es den einen oder anderen Psalm, der Ihnen etwas zu sagen hat und hilfreiche Anhaltspunkte für Ihr persönliches Gebet bereithält.
[2] Packer, J. I., Concise Theology (Tyndale House, 1993), S. 187.
[3] Ebda.
[4] Foster, R., Celebration of Discipline (Hodder & Stoughton, 1989), S. 43.
[5] Packer, Concise Theology, S. 23.
[6] Green, J. B., McKnight, S., Marshall, I. H. (Hrsg.) The Dictionary of Jesus and the Gospels (Intervarsity Press, 1992), S. 621-622.
[7] Ebda., S. 622.
[8] McKim, D. K., Westminster Dictionary of Theological Terms (Westminster John Knox Press, 1996), S. 215.
[9] Foster, S. 49.
© Stiftung WKG in Deutschland

